Früher wurden Grusel-Hörspiele von Autoren erdacht, von Schauspielern mit Leben gefüllt und von
Regisseuren in Szene gesetzt, die sich sowohl privat als auch beruflich mit Kultur beschäftigt haben und aus
finanziellen Gründen - teils mit Galgenhumor, teils mit der Einstellung `machen wir einfach das Beste daraus´-
an besagten Produktionen mitwirkten. Heute werden diese Genre-Hörspiele von Zeitgenossen realisiert,
die privat ebenfalls 'Horror' konsumieren (aktuell bei der grauenhaften Gruselserien-Fortsetzung zu beobachten).
Das macht leider den hörbaren Unterschied aus.
Diese Seite versteht sich daher als Reminiszenz an Könner wie
Jürgen Grasmück (alias 'Dan Shocker'), Horst Frank, Judy Winter,
Gottfried Keller, Douglas Welbat, Hans Clarin, Marianne Kehlau, Günther Pfitzmann, Hans Paetsch, Brigitte Kollecker und viele andere.


Heikedine Körtings Mitwirken beim EUROPA-Label haben nicht nur zahlreiche Kinder- und Jugendhörspiele ihre Bestform zu verdanken, sondern auch diverse Vertonungen 'für Erwachsene', bei denen Schauspiel- und Theatergrößen wie Horst Frank, Judy Winter, Helmut Zierl und viele andere mitwirkten. Sicher nicht zuletzt, da sie dank Frau Körting ein solides Maß an Seriosität auch bei etwas heikleren Hörspielstoffen zu garantiert vermochten. Nachfolgend subjektive Kurzrezensionen der Erfolgsserien 'Larry Brent' und 'Macabros' aus den Achtziger Jahren, die KEINESFALLS als Kaufempfehlungen fehlzuinterpretieren sind:
|
REZENSION MACABROS 1 und 2
Im Bathyscaph auf Quallenjagd
 Nyreen Matobish erbt in der ersten Macabros-Folge 'Der Fluch der Druidin' vom Antiquitätenhändler Lawrence Clearwater ein altes verkommenes Haus auf einer kleinen irischen Insel. Als sie wegen eines Unwetters gemeinsam mit der Erbengemeinschaft eine Nacht in den düsteren Räumen dieses Gebäudes zubringt, schlägt der Geist einer im Mittelalter verfolgten Druidin zu. Lawrence Clearwater hatte offenbar nicht vorgehabt, seine Nachkommenschaft zu beglücken - ganz im Gegenteil. Nyreen Matobish erbt in der ersten Macabros-Folge 'Der Fluch der Druidin' vom Antiquitätenhändler Lawrence Clearwater ein altes verkommenes Haus auf einer kleinen irischen Insel. Als sie wegen eines Unwetters gemeinsam mit der Erbengemeinschaft eine Nacht in den düsteren Räumen dieses Gebäudes zubringt, schlägt der Geist einer im Mittelalter verfolgten Druidin zu. Lawrence Clearwater hatte offenbar nicht vorgehabt, seine Nachkommenschaft zu beglücken - ganz im Gegenteil.
Der Serienstart wartet gleich mit der vermutlich härtesten Folge der Reihe auf. Auf der kleinen irischen Insel geht es drastisch und wenig vornehm zur Sache. Musikauswahl und Hintergrundgeräusche lassen eine erschreckend düstere Atmosphäre entstehen. Die Phantasie wird auf jeden Fall enorm angeregt, da können selbst die längeren Monologe des Protagonisten (verschmilzt mit seiner Rolle: Darsteller und Drehbuchautor Douglas Welbat) dessen Unterwasser-Odyssee nichts von ihrer fesselnden Spannung nehmen.
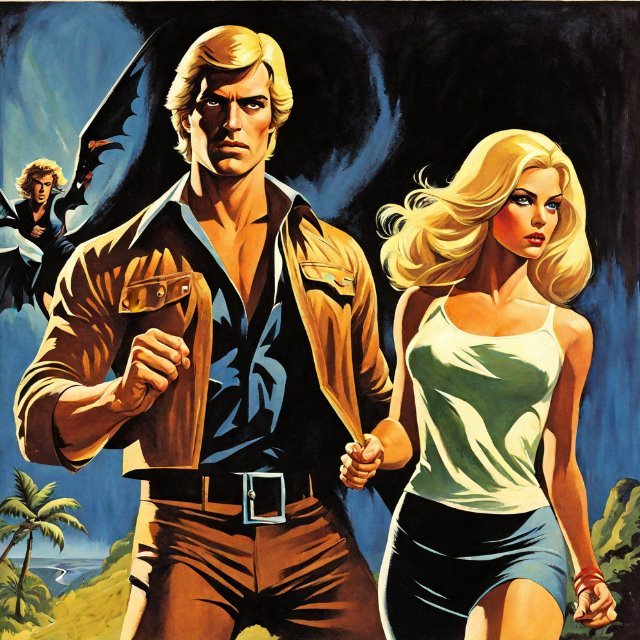 In der zweiten Macabros-Folge 'Attacke der Untoten' geht es um Howard Rox, über den unheimliche Dinge erzählt werden. Es gibt Menschen, die behaupten, er könne sich in einen Werwolf verwandeln. Andere wiederum behaupten, er sei ein Vampir - niemand weiß Genaues, doch fest steht: Etwas stimmt nicht mit diesem unheimlichen Mann. Als von den nahegelegenen Farmen immer mehr Frauen und Mädchen auf mysteriöse Weise verschwinden, schaltet sich Björn Hellmark ein. Da aber hat Rox bereits eine Armee von Untoten geschaffen.
In der zweiten Macabros-Folge 'Attacke der Untoten' geht es um Howard Rox, über den unheimliche Dinge erzählt werden. Es gibt Menschen, die behaupten, er könne sich in einen Werwolf verwandeln. Andere wiederum behaupten, er sei ein Vampir - niemand weiß Genaues, doch fest steht: Etwas stimmt nicht mit diesem unheimlichen Mann. Als von den nahegelegenen Farmen immer mehr Frauen und Mädchen auf mysteriöse Weise verschwinden, schaltet sich Björn Hellmark ein. Da aber hat Rox bereits eine Armee von Untoten geschaffen.
Die Story ist immer noch packender als manch anderer Gruselroman, jedoch im Vergleich mit dem Niveau der übrigen Vertonungen hinterherhinkend. So prädestiniert dieser Schauspieler für die Rolle des psychopathischen Bösewichts seit nunmehr drei Jahrzehnten zweifellos ist - Horst Frank als Dirk Toesfeld in Folge 3 der Serie hätte doch vielleicht genügt.
|
REZENSION MACABROS 3 und 4
Das Quaken zur Nachtzeit
 Der kauzige Dietrich Tössfeld ist Sammler okkulter Gegenstände und besessen von dem Gedanken, dass gerade in Fröschen Dämonen und böse Geister hausen und sie als Wirtskörper benutzen. In der dritten Macabros-Folge 'Konga, der Menschenfrosch' entführt Tössfeld einen Forscher, der mit den Lurchen in Tierversuchen wenig zimperlich umgeht und behandelt ihn genau so, wie er selber die gefangenen Frösche bisher behandelt hat. Hellmark erscheint auf der norddeutschen Szene, denn Tössfeld besitzt eine Maske, die für ihn später noch von großem Wert sein soll. Der kauzige Dietrich Tössfeld ist Sammler okkulter Gegenstände und besessen von dem Gedanken, dass gerade in Fröschen Dämonen und böse Geister hausen und sie als Wirtskörper benutzen. In der dritten Macabros-Folge 'Konga, der Menschenfrosch' entführt Tössfeld einen Forscher, der mit den Lurchen in Tierversuchen wenig zimperlich umgeht und behandelt ihn genau so, wie er selber die gefangenen Frösche bisher behandelt hat. Hellmark erscheint auf der norddeutschen Szene, denn Tössfeld besitzt eine Maske, die für ihn später noch von großem Wert sein soll.
 Hier müsste eigentlich das Herz eines jeden Gegners von Tierversuchen höher schlagen: Den Spieß einmal umkehrend wird tatsächlich ein Wissenschaftler von einem Riesenfrosch viviseziert. Folgen wie diese helfen dem Zuhörer, Dan Shockers Namensgebung für seine Serie besser nachzuvollziehen. Ideal besetzt: Horst Frank als unheimlicher Wächter der Dämonenmaske.
Hier müsste eigentlich das Herz eines jeden Gegners von Tierversuchen höher schlagen: Den Spieß einmal umkehrend wird tatsächlich ein Wissenschaftler von einem Riesenfrosch viviseziert. Folgen wie diese helfen dem Zuhörer, Dan Shockers Namensgebung für seine Serie besser nachzuvollziehen. Ideal besetzt: Horst Frank als unheimlicher Wächter der Dämonenmaske.
Durch die Zeitschrift "Amazing Tales" erfährt Björn Hellmark in der dritten Macabros-Folge 'Der Horror-Trip' von einem Mann, der nach dreijähriger Abwesenheit wieder in London aufgetaucht ist, ohne sagen zu können, wo er die ganze Zeit über gewesen war. Dieser gewisse Edgar Laughton ist auch in der realen Welt ständigen Angriffen aus der vierten Dimension ausgesetzt. Während Hellmark ihn verteidigt und hinter das Geheimnis der vierten Dimension kommen will, trifft er auf eine geheimnisvolle Frau, die vor dreißig Jahren schon in ihrem Haus lebte, dann unauffindbar verschwand, heute wieder dort lebt und um keinen Tag gealtert ist.
Eine fast sympathische Schreckensgöttin, die eines ihrer unwilligen Opfer eigentlich lieber bemuttern möchte, statt es zu eliminieren, beweist einmal mehr, dass Dan Shocker es seinerzeit vorzüglich verstand, auch die dunklen Charaktere seiner Gruselreihe differenziert und nicht nach dem bekannten Schwarz-Weiß-Muster, das in diesem Genre leider viel zu oft Konjunktur hat, darzustellen. Dies hebt ihn klar von weniger rühmlichen Vertretern seiner Zunft ab.
Frösche spielen übrigens auch in H. Lührs Hörspiel 'Gut gebrüllt, Leo!' (Ausschnitt) eine ganz spezielle Rolle.
|
REZENSION MACABROS 5 und 6
Falscher Mann, richtiger Thron
 Ein Seglerpärchen glaubt sich in der fünften Macabros-Folge 'Die Geister-Höhlen' allein auf einer Insel, von der es wegen eines defekten Trimarans nicht mehr weg kommt. Andrew und Julia stoßen auf den Eingang einer unheimlichen Höhle, in deren unergründlichen Schwärze ein gigantischer Totenkopf von Zeit zu Zeit aufglimmt - und wieder erlischt. Andrew kann seine Neugierde nicht bezwingen und wagt es, die Höhle zu erforschen. Gleichzeitig haben Molochos und seine Helfershelfer dafür gesorgt, dass der Segler anstelle Björn Hellmarks die Weissagungen der weißen Priester in der Höhle vernimmt. Als Hellmark eintrifft, sind sie größtenteils wirkungslos 'verpufft'.
Ein Seglerpärchen glaubt sich in der fünften Macabros-Folge 'Die Geister-Höhlen' allein auf einer Insel, von der es wegen eines defekten Trimarans nicht mehr weg kommt. Andrew und Julia stoßen auf den Eingang einer unheimlichen Höhle, in deren unergründlichen Schwärze ein gigantischer Totenkopf von Zeit zu Zeit aufglimmt - und wieder erlischt. Andrew kann seine Neugierde nicht bezwingen und wagt es, die Höhle zu erforschen. Gleichzeitig haben Molochos und seine Helfershelfer dafür gesorgt, dass der Segler anstelle Björn Hellmarks die Weissagungen der weißen Priester in der Höhle vernimmt. Als Hellmark eintrifft, sind sie größtenteils wirkungslos 'verpufft'.
Krimi, Mystik und Verfolgungsjagd geben sich hier ein munteres Stelldichein. Ein Dämonenfürst, der fast an seinem unterbelichteten Helfer verzweifelt, würde wahrscheinlich beinahe das Mitgefühl der Hörer wecken, wenn diese nicht gerade voll damit ausgelastet wären, der detail- und an Untertönen reichen, rasanten Handlung zu folgen.
 In der sechsten Macabros-Folge 'Der Blutregen' geht es um das Schicksal von Camilla Davies, die ein bekanntes und talentiertes 'Medium' ist, also mit dem Reich der Toten Kontakt aufnehmen kann. Ein Wissenschaftler-Team, das an der Erforschung parapsychologischer Phänomene arbeitet, will ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten testen. An einem geheimgehaltenen Ort findet eine Seance statt. Aber etwas Merkwürdiges geschieht, das auch Camilla nicht gewollt hat: Sie verschwindet aus dem abgeschlossenen Raum, lässt dafür jede Menge Ektoplasma zurück und taucht an einem vollkommen anderen bedrohlichen Ort wieder auf.
In der sechsten Macabros-Folge 'Der Blutregen' geht es um das Schicksal von Camilla Davies, die ein bekanntes und talentiertes 'Medium' ist, also mit dem Reich der Toten Kontakt aufnehmen kann. Ein Wissenschaftler-Team, das an der Erforschung parapsychologischer Phänomene arbeitet, will ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten testen. An einem geheimgehaltenen Ort findet eine Seance statt. Aber etwas Merkwürdiges geschieht, das auch Camilla nicht gewollt hat: Sie verschwindet aus dem abgeschlossenen Raum, lässt dafür jede Menge Ektoplasma zurück und taucht an einem vollkommen anderen bedrohlichen Ort wieder auf.
Wer hätte das gedacht: Helmut Zierl, im TV durchweg als sympathischer Schwiegersohntyp besetzter Heile-Welt-Mime, gibt hier sein absolut überzeugendes Debüt als zynisch-süffisanter Dämonenfürst und befördert diese Folge damit zum absoluten Highlight der Serie. Die drastisch geschilderten Probleme eines nach einer außer Kontrolle geratenen Séance auf die andere Seite des Erdballs verschlagenen Mediums tragen ebenfalls zur ausgesprochen abwechslungsreichen Unterhaltung der gebannten Hörer bei.
|
REZENSION MACABROS 7 und 8
Rotweinflecken gehen nicht mehr raus

 In der siebten Macabros-Folge 'Duell mit den Höllengeistern' wird Pierre Barlon von finsteren Mächten erpresst: Sollte es ihm nicht gelingen, Björn Hellmark ins Jenseits zu befördern, so würden seine Frau und seine Tochter dafür bezahlen müssen. So macht sich Pierre Barlon also schweren Herzens auf dem Weg in die Schweiz, um Hellmark heimtückisch zu beseitigen. Was er nicht weiß: Frau und Tochter stehen selber mit den Mächten der Finsternis in Kontakt und greifen später in das Geschehen ein als sich abzeichnet, dass Pierre seinen Auftrag nicht erfüllen kann. Noch dazu taucht eine zweite Carminia Brado in Hellmarks Villa auf. Welcher ist zu trauen ? In der siebten Macabros-Folge 'Duell mit den Höllengeistern' wird Pierre Barlon von finsteren Mächten erpresst: Sollte es ihm nicht gelingen, Björn Hellmark ins Jenseits zu befördern, so würden seine Frau und seine Tochter dafür bezahlen müssen. So macht sich Pierre Barlon also schweren Herzens auf dem Weg in die Schweiz, um Hellmark heimtückisch zu beseitigen. Was er nicht weiß: Frau und Tochter stehen selber mit den Mächten der Finsternis in Kontakt und greifen später in das Geschehen ein als sich abzeichnet, dass Pierre seinen Auftrag nicht erfüllen kann. Noch dazu taucht eine zweite Carminia Brado in Hellmarks Villa auf. Welcher ist zu trauen ?
Diese Folge besticht durch ihr geschickt inszeniertes Verwirrspiel um die Intrigen der Gegenspieler Björn Hellmarks. Für die weibliche Kontrahentin der Hauptfigur hätte man keine bessere Schauspielerin verpflichten können als Judy Winter, der ihre Doppelrolle als treusorgende Ehefrau und Dämonin hörbar Spaß bereitet.
Hans Leibold war schon immer ein reichlich schräger Vogel, dem normale Leute aus dem Weg gingen. Seinem neuesten okkulten Hobby geht er regelmäßig auf Friedhöfen nach. Ein gewisser Joseph Brunner, ein vor seinem Hinscheiden äußerst übler Zeitgenosse, stellt Leibold in der achten Macabros-Folge 'Im Leichenlabyrinth' unendliche Macht in Aussicht, wenn er für ihn und seine Totenarmee zum Mörder wird. Da trifft es sich äußerst ungünstig, dass eine quirlige Familie in der Nähe des Friedhofs versucht, wieder Frieden miteinander zu schließen.
Die sehr makaberen Geschehnisse um eine Armee von Untoten werden den Zuhörern durch die geschickte Einbeziehung einer zerstrittenen Familie versüßt. Hier hätte sich der Handlungsfaden leicht ins Geschmacklose verirren können, aber Grasmück hält knapp die Balance zwischen Tabubruch und einigermaßen seriöser Erwachsenen-Unterhaltung. Auch die Gestaltung des ersten vermeintlichen erotischen Abenteuers der Hauptfigur geriet den Hörspielmachern unverkrampft.
|
REZENSION MACABROS 9 und 10
Der Killer mit dem schwachen Herzen
 Der bezahlte Killer mit dem sinnigen Namen Phil Hunter muss sich in der neunten Macabros-Folge 'Molochos Totenkarussell' einer Herzoperation unterziehen. Dabei hat er während der Vollnarkose ein sehr beunruhigendes Erlebnis: Er ist sich sicher, einen Blick in die Hölle zu werfen und den Menschen zu begegnen, die er zuvor gnadenlos gegen Bezahlung ins Jenseits befördert hat. Der Traum wiederholt sich immer und immer wieder und wird zur regelmäßigen Qual. Besonders erschrocken ist er, als ihm im Traum eine Schwester vom Pflegepersonal begegnet, die passend zur neuen Umgebung, überhaupt nicht zimperlich mit ihm umspringt. Hellmark muss mal wieder retten, was noch zu retten ist - was ihm leichter fallen würde, hätte Carminia nicht seine Dämonenmaske verbummelt. Der bezahlte Killer mit dem sinnigen Namen Phil Hunter muss sich in der neunten Macabros-Folge 'Molochos Totenkarussell' einer Herzoperation unterziehen. Dabei hat er während der Vollnarkose ein sehr beunruhigendes Erlebnis: Er ist sich sicher, einen Blick in die Hölle zu werfen und den Menschen zu begegnen, die er zuvor gnadenlos gegen Bezahlung ins Jenseits befördert hat. Der Traum wiederholt sich immer und immer wieder und wird zur regelmäßigen Qual. Besonders erschrocken ist er, als ihm im Traum eine Schwester vom Pflegepersonal begegnet, die passend zur neuen Umgebung, überhaupt nicht zimperlich mit ihm umspringt. Hellmark muss mal wieder retten, was noch zu retten ist - was ihm leichter fallen würde, hätte Carminia nicht seine Dämonenmaske verbummelt.
Eine ein doppeltes Spiel verfolgende Krankenschwester, eine selbstbewusste Hausfrau, durchaus kritisch anklingende Schilderungen zweifelhafter Geheimdienstpraktiken sowie ein vermeintlicher Scheuerlappen sind die rechten Zutaten für einen Gruselkrimi par excellence.
 Jahrelang war James Owen nicht mehr zu Hause, sondern hat als Seefahrer und Abenteurer die halbe Welt bereist. Dann kehrt er in der zehnten und letzten Macabros-Folge 'Die Knochensaat' zurück nach England. Er ist reichlich mitgenommen - es hat ihn erwischt ... Seine Frau erkennt ihn kaum wieder, denn er ist ziemlich vom Fleisch gefallen. Er hat sich auf der Suche nach einem unendlichen Goldschatz mit der gefährlichen Knochen-Saat infiziert und breitet sie jetzt in England aus. Hellmark versucht, dies zu verhindern und reist daher nach Mexiko, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Jahrelang war James Owen nicht mehr zu Hause, sondern hat als Seefahrer und Abenteurer die halbe Welt bereist. Dann kehrt er in der zehnten und letzten Macabros-Folge 'Die Knochensaat' zurück nach England. Er ist reichlich mitgenommen - es hat ihn erwischt ... Seine Frau erkennt ihn kaum wieder, denn er ist ziemlich vom Fleisch gefallen. Er hat sich auf der Suche nach einem unendlichen Goldschatz mit der gefährlichen Knochen-Saat infiziert und breitet sie jetzt in England aus. Hellmark versucht, dies zu verhindern und reist daher nach Mexiko, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Das Südamerika-Abenteuer machte den Abschied von den Hörspielvertonungen der Serie besonders schwer, wurde doch hier mit 'Pepe' erstmals eine weitere tragende Figur der Serie neben Hellmark, Brado, Mahay und Mertus gelungen in Szene gesetzt. Aber dieses Phänomen kennt man ja spätestens seit der Glanzbesetzung von Gucky in der letzten Folge der Perry Rhodan-Vertonung von 1984 .
|
MACABROS-FUNDSTÜCKE I
Harry Brents Ufo-Hysterie
 Stellt man sich die Frage, wer oder was Jürgen Grasmück alias Dan Shocker Anfang der siebziger Jahre für die Namensgebung einer seiner beiden erfolgreichen Gruselserien inspiriert haben könnte, lohnt ein Blick in das Fernsehprogramm aus jenen Tagen: Hier finden wir im Jahr 1968 den 3-teiligen Krimi `Ein Mann namens Harry Brent´ von Francis Durbridge. Offenbar scheint Shockers Figur Larry einen prominenten Ziehvater gehabt zu haben, denn die Durbridge-Krimis waren seinerzeit die reinen 'Straßenfeger'.
Stellt man sich die Frage, wer oder was Jürgen Grasmück alias Dan Shocker Anfang der siebziger Jahre für die Namensgebung einer seiner beiden erfolgreichen Gruselserien inspiriert haben könnte, lohnt ein Blick in das Fernsehprogramm aus jenen Tagen: Hier finden wir im Jahr 1968 den 3-teiligen Krimi `Ein Mann namens Harry Brent´ von Francis Durbridge. Offenbar scheint Shockers Figur Larry einen prominenten Ziehvater gehabt zu haben, denn die Durbridge-Krimis waren seinerzeit die reinen 'Straßenfeger'.
In Macabros Nr. 50 `Rha-Ta-N`mys Leichenschlucht´ kommen Björn Hellmark und Larry Brent tatsächlich zusammen. In der Folge gerät eine große Filmgesellschaft ins Trudeln, bei der während der Dreharbeiten Filmszenen Realität werden: Straßen brechen auf, Häuser stehen in Flammen, Flugzeuge explodieren, Flutwellen ergießen sich über das Land. Hätte EUROPA doch die Macabros- Hörspielproduktion bis Folge 50 durchgehalten!  Ihre sämtlichen archivierten Hintergrundgeräusche hätten sie hier zum Einsatz kommen lassen können. Ein weiteres Stelldichein ergab sich 1984 zwischen den Schauspielern Rainer Schmitt und Douglas Welbat: In der öffentlich-rechtlichen Hörspielproduktion `Kampf um Kreuzberg´ von Peter Gollan stehen sich Schmitt (alias Larry Brent) und Welbat (alias Björn Hellmark) als `Superbulle´ (Schmitt) und Hausbesetzer (Welbat) gegenüber. Diese Produktion bescherte ihren Zuhörern seinerzeit, fast genauso wie die Shocker-Produkte, ein harmonisches Ende. Ihre sämtlichen archivierten Hintergrundgeräusche hätten sie hier zum Einsatz kommen lassen können. Ein weiteres Stelldichein ergab sich 1984 zwischen den Schauspielern Rainer Schmitt und Douglas Welbat: In der öffentlich-rechtlichen Hörspielproduktion `Kampf um Kreuzberg´ von Peter Gollan stehen sich Schmitt (alias Larry Brent) und Welbat (alias Björn Hellmark) als `Superbulle´ (Schmitt) und Hausbesetzer (Welbat) gegenüber. Diese Produktion bescherte ihren Zuhörern seinerzeit, fast genauso wie die Shocker-Produkte, ein harmonisches Ende.
Auf dem Höhepunkt einer der ersten UFO-Hysterie-Wellen forderte Dan Shocker tatsächlich seine Leser auf, nach unbekannten Flugobjekten Ausschau zu halten (vornehmlich auf Gran Canaria) und diese möglichst auch zu fotografieren, was ihm selber leider nie gelungen sei. Wahrscheinlich ließ sich Shocker von dem damals ebenso populären als auch umstrittenen Erich von Däniken zu diesem geistigen Tiefschlag inspirieren. Kann sich ein Leser dieses Artikels durch diesen Hinweis bereichert nun vielleicht nachträglich daran erinnern, im Sommerurlaub Anno `74 auf oben genannter Insel einen aufgeregten Mittdreißiger mit bemerkenswert beissfesten Zähnen mit der Fotokamera den Himmel absuchend gesehen zu haben ? Wenn ja - jetzt weiß man endlich, was dahintersteckte.
|
MACABROS-FUNDSTÜCKE II
Vom Stolz auf gute Beißinstrumente
 Ein fürsorglicher Grusel-Fan riet Grasmück bezüglich des regelmäßig im Romanheft abgebildeten Vampir-Look-Konterfeis des Autors "Wenn Ihnen Ihre Eckzähne irgendwann einmal zu lang werden, dann kauen Sie doch einfach regelmäßig Sandpapier; Ein Rat meines Hausvampirs." Diesen Rat wies der den Sorgen seiner Gefolgschaft gegenüber reichlich unsensible Grasmück jedoch seinerzeit mit dem Hinweis zurück, dass er sich hüten werde, seine Zähne zu kürzen. Sie seien sein ganzer Stolz und zudem die einzigen, die noch etwas taugten. Sicher handelte es sich bei dem Fabrikat noch um 'deutsche Wertarbeit' und um keinen 'Fujiyama-HongKong-Kram' (Douglas Welbat als Verkäufer in 'Mitten in der Masse').
Ein fürsorglicher Grusel-Fan riet Grasmück bezüglich des regelmäßig im Romanheft abgebildeten Vampir-Look-Konterfeis des Autors "Wenn Ihnen Ihre Eckzähne irgendwann einmal zu lang werden, dann kauen Sie doch einfach regelmäßig Sandpapier; Ein Rat meines Hausvampirs." Diesen Rat wies der den Sorgen seiner Gefolgschaft gegenüber reichlich unsensible Grasmück jedoch seinerzeit mit dem Hinweis zurück, dass er sich hüten werde, seine Zähne zu kürzen. Sie seien sein ganzer Stolz und zudem die einzigen, die noch etwas taugten. Sicher handelte es sich bei dem Fabrikat noch um 'deutsche Wertarbeit' und um keinen 'Fujiyama-HongKong-Kram' (Douglas Welbat als Verkäufer in 'Mitten in der Masse').
 Ein durchgeknallter Dan Shocker-Fan dichtete 1974 folgende Zeilen auf Hellmarks treuen Weggefährten vom indischen Subkontinenten: `Da ist noch der Rani / der`Koloss aus Bhutan´ / Im Stich lässt er Björn nie, / ihm hätt´s sonst leid getan´ - nun ja ... Auch andere bemühten sich, den Grusel-Hype auch außerhalb der Romanhefte weiterzuentwickeln: In einer Discothek in der Nähe von Hannover lief ungefähr im Jahr 1984 eine Show mit dem Titel `Orungu, Fratze aus dem Dschungel´, den Shocker-Fans als Titel eines Larry Brent-Romans lebhaft in Erinnerung. Ob die Veranstaltung ein kommerzieller oder wenigstens ästhetischer Erfolg wurde, ist leider nicht überliefert.
Ein durchgeknallter Dan Shocker-Fan dichtete 1974 folgende Zeilen auf Hellmarks treuen Weggefährten vom indischen Subkontinenten: `Da ist noch der Rani / der`Koloss aus Bhutan´ / Im Stich lässt er Björn nie, / ihm hätt´s sonst leid getan´ - nun ja ... Auch andere bemühten sich, den Grusel-Hype auch außerhalb der Romanhefte weiterzuentwickeln: In einer Discothek in der Nähe von Hannover lief ungefähr im Jahr 1984 eine Show mit dem Titel `Orungu, Fratze aus dem Dschungel´, den Shocker-Fans als Titel eines Larry Brent-Romans lebhaft in Erinnerung. Ob die Veranstaltung ein kommerzieller oder wenigstens ästhetischer Erfolg wurde, ist leider nicht überliefert.
Für die Bennenung einiger seiner Figuren hat sich Grasmück dem Vernehmen nach auch von den Namen seiner Freunde und Bekannten inspirieren lassen. Es folgen sieben von nahezu unüberschaubar vielen möglichen Beweisen für Jürgen Grasmücks wortschöpferische Qualitäten: Die Namen der schwarzen Priester Xantilons (in hierarchischer Reihenfolge): Quappa Orgep, Manko Tarlep, Yron, Apron Kaa, Vartan Konk, Ontar Muoll und Dwahl. Man fragt sich im Stillen: Was hatte der Mann denn bloß für seltsame Freunde ?
|
REZENSION LARRY BRENT 1 und 2
Schutzlose Vampire und ein irrer Professor

 Professor Torrence und seine Mitstreiter wollen in der ersten Larry-Brent-Folge 'Irrfahrt der Skelette' die Weltherrschaft an sich reissen. Ermöglichen soll ihnen dies ein Kampfgas, welches Menschen, die damit in Berührung kommen, innerhalb von Sekunden zu Skeletten werden lässt. Auf einer Südsee-Kreuzfahrt soll Larry Brent den Professor, der als Passagier mit an Bord der `Andrea Morena´ ist, aufzuhalten versuchen.
Professor Torrence und seine Mitstreiter wollen in der ersten Larry-Brent-Folge 'Irrfahrt der Skelette' die Weltherrschaft an sich reissen. Ermöglichen soll ihnen dies ein Kampfgas, welches Menschen, die damit in Berührung kommen, innerhalb von Sekunden zu Skeletten werden lässt. Auf einer Südsee-Kreuzfahrt soll Larry Brent den Professor, der als Passagier mit an Bord der `Andrea Morena´ ist, aufzuhalten versuchen.
Eine makabere aber leider trotzdem gar nicht so unrealistische Handlung um ein tödliches Kampfgas. Südsee-Idylle und Agenten-Action werden im Hörspiel gleichermaßen von kitschiger (vermeintlicher) Karibik-Folklore untermalt. Beinahe überflüssig zu erwähnen, dass Horst Frank (er spielt in insgesamt zwei Brent-Folgen den Bösewicht) als Professor Torrence wieder einmal glänzend besetzt ist. Auch Marianne Kehlau als wohlbeleibte Kreuzfahrtteilnehmerin auf Freierssuche macht das Stück zusätzlich hörenswert.
Der Marotsch jagt Vampire in Wien. Er benötigt fünfzig echte Vampirherzen. Um sein Ziel zu erreichen, sorgt er in der zweiten Larry-Brent-Folge 'Marotsch, der Vampir-Killer' sogar dafür, dass weitere Menschen zu Blutsaugern werden. Doch einige seiner Opfer beginnen sich gegen ihn zu wehren. Larry Brent und Iwan Kunaritschews versuchen ihnen dabei zu helfen, aber oft sieht es so aus, als kämen sie zu spät.
Eine recht blutrünstige und an einigen Stellen übertrieben harte Geschichte, die jedoch durch drastische Spannungselemente sowie einige Abschnitte, in denen es rührend `menschelt´, ergänzt wird und somit letztendlich doch abwechslungsreich unterhält. Die Protagonisten werden gut beschrieben und wirken weder stereotyp noch eindimensional. Gottfried Kramer als der Marotsch klingt gefährlicher als man es von ihm erwarten durfte. Ihm haben Europas Dan-Shocker-Vertonungen nicht viel weniger zu verdanken als dem einmaligen Horst Frank.
|
REZENSION LARRY BRENT 3 und 4
Frische Klone und ein muffiges Schloss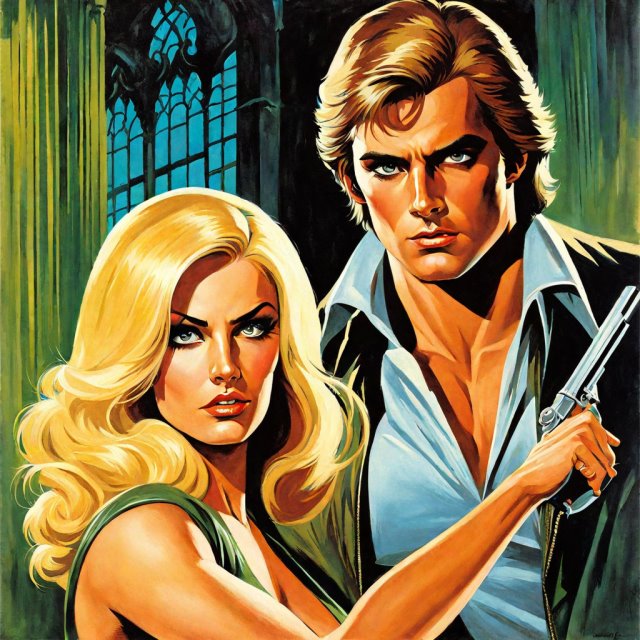
 Die Bewohner des Schlosses von Sir George, Duke of Hutchingdon, werden in der dritten Larry-Brent-Folge 'Die Angst erwacht im Todesschloss' von brutalen Gangstern erpresst, die den Familiensitz als Unterschlupf nutzen. Neugierige, die sich zu weit in das Schloss hineinwagen, kommen auf mysteriöse Weise ums Leben. Das müssen leider auch die Tochter von Sir George und ihr Verlobter am eigenen Leib erfahren. Sie hätten ihren Besuch im Schloss doch lieber vorher anmelden sollen ... Die Bewohner des Schlosses von Sir George, Duke of Hutchingdon, werden in der dritten Larry-Brent-Folge 'Die Angst erwacht im Todesschloss' von brutalen Gangstern erpresst, die den Familiensitz als Unterschlupf nutzen. Neugierige, die sich zu weit in das Schloss hineinwagen, kommen auf mysteriöse Weise ums Leben. Das müssen leider auch die Tochter von Sir George und ihr Verlobter am eigenen Leib erfahren. Sie hätten ihren Besuch im Schloss doch lieber vorher anmelden sollen ...
Das Hörspiel liefert einige wirklich gruselige Momente und darüber hinaus knallharte Agenten-Action á la 'James Bond'. Entgegen dem ersten Anschein walten im Schloss keine unerklärlichen oder gar übernatürlichen Kräfte, was einmal eine willkommene Abwechslung vom sonstigen Monster-Kreaturen-Mutationen-Motto der Serie ist.
Ein chinesischer Forscher beschäftigt sich in der vierten Larry-Brent-Folge 'Die Monster-Maschine' mit genetischen Experimenten, mit deren Hilfe er aus unfreiwilligen Probanten gefährliche Ungetüme klont. Seine Geschöpfe vergreifen sich zunehmend an Unbeteiligten. Um dem Treiben des irren Forschers ein Ende zu bereiten, tarnt sich Larry Brent zunächst selber als Leiche.
Wenn man den Zeitpunkt des Erscheinens dieses Romans Anfang der 70er Jahre bedenkt, muss man zugeben, dass Shocker in dieser Story mit der Gentechnik recht frühzeitig ein heißes Eisen anpackt. Dies gelingt ihm jedoch nicht wirklich. Die genetische Gänsehaut bleibt oberflächlich und auf vordergründige Gruseleffekte beschränkt. Leider gleitet das Hörspiel an einigen Stellen beinahe ins Sadistische ab. Etwas weniger Realismus bei der Darstellung der vor Schreck ihre Stimme verloren habenden Chinesin wäre dem Stück sicher nicht abträglich gewesen. Bemerkenswert immerhin der relativ lange Monolog eines Chinesen im O-Ton: Hier hat man bei EUROPA wirklich mit Liebe zum Detail gearbeitet.
|
REZENSION LARRY BRENT 5 und 6
Weder Düsseldorf noch Essen
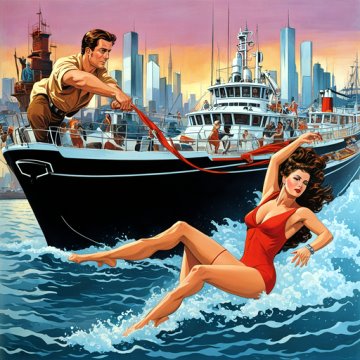
 Was zunächst als geschmackloser Streich geplant war, endet für zwei junge Frauen aus Düsseldorf in der fünften Larry-Brent-Folge 'Chopper - Geisterstimme aus dem Jenseits' tödlich. Nachdem ein Arbeitskollege einer der beiden mit Hilfe einer alten Beschwörungsformel den Chopper-Dämon auf den Hals gehetzt hat, wird diese zu dessen willigem Gefäß und läuft Amok. Zudem haben weitere dunkle Mächte Interesse an der Kontrolle des Choppers. Was zunächst als geschmackloser Streich geplant war, endet für zwei junge Frauen aus Düsseldorf in der fünften Larry-Brent-Folge 'Chopper - Geisterstimme aus dem Jenseits' tödlich. Nachdem ein Arbeitskollege einer der beiden mit Hilfe einer alten Beschwörungsformel den Chopper-Dämon auf den Hals gehetzt hat, wird diese zu dessen willigem Gefäß und läuft Amok. Zudem haben weitere dunkle Mächte Interesse an der Kontrolle des Choppers.
Die Tragik eines aus Leichtsinn ausgelösten Schreckenskarussells wird hier ergänzt durch die spannenden und streckenweise recht humorvoll inszenierten Bemühungen Larry Brents, einer unübersichtlichen und bedrohlichen Situation Herr zu werden. Die Story bedient sich in gekonnter gegenseitiger Ergänzung sowohl des Agenten- als auch des Gruselroman-Genres. Mit ihr setzte Jürgen Grasmück alias Dan Shocker der Stadt Düsseldorf, zu der er anscheinend ein besonders inniges Verhältnis hat, ein Denkmal (bleibt zu hoffen, dass man dies dort zu schätzen weiß ...).
 Der vor zwanzig Jahren in London hingerichtete Mörder Derry Cromfield taucht in der sechsten Larry-Brent-Folge 'Im Kabinett des Grauens' plötzlich in einem Flugzeug nach New York auf und tötet den Piloten, der ein Neffe seines Henkers war. Danach schwört er auch der restlichen Verwandtschaft des Vollstreckers blutige Rache. An der Wiederbelebung der Schreckensfigur ist dessen Bruder, der in London ein gutgehendes Wachsfigurenkabinett besitzt, offenbar nicht ganz unbeteiligt.
Der vor zwanzig Jahren in London hingerichtete Mörder Derry Cromfield taucht in der sechsten Larry-Brent-Folge 'Im Kabinett des Grauens' plötzlich in einem Flugzeug nach New York auf und tötet den Piloten, der ein Neffe seines Henkers war. Danach schwört er auch der restlichen Verwandtschaft des Vollstreckers blutige Rache. An der Wiederbelebung der Schreckensfigur ist dessen Bruder, der in London ein gutgehendes Wachsfigurenkabinett besitzt, offenbar nicht ganz unbeteiligt.
Die turbulente Anfangsszene in der gerade erst aus Essen gestarteten Boeing 707 gehört zu den amüsantesten der Serie. Schrecken und teilweise ironischer Humor liegen auch in dieser Folge wieder einmal eng beieinander. Die Geschehnisse um ein mysteriöses Wachsfigurenkabinett, ein Film-Starlett, zwei Kleinkriminelle und die Nöte einer Henkersfamilie entlassen den Hörer nicht für eine Minute aus ihrem Bann. Das Ganze wird schließlich noch durch die Besetzung des bewährten Horst Frank als wahnsinnig-genialem und unfreiwillig komischem Wissenschaftler abgerundet.
|
REZENSION LARRY BRENT 7 und 8
Vegetarische Girls und fleischfressende Raupen
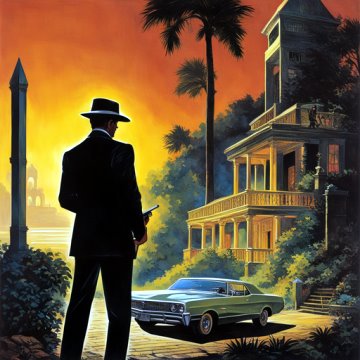
 Der populäre englische Krimi-Autor Richard Burling mietet in der siebten Larry-Brent-Folge 'Das Totenhaus der Lady Florence' eine alte Villa, die seit dem Tod von Lady Florence leer steht. Angeblich will er dort seinen neuesten Thriller vollenden, doch dies ist nur eine Scheintätigkeit. In Wahrheit hat er ein gefährliches Serum entwickelt, welches unsichtbar macht, allerdings auch noch eine tödliche Nebenwirkung aufweist. Jetzt sind jedoch die verschiedensten Agentenringe hinter ihm her. Der populäre englische Krimi-Autor Richard Burling mietet in der siebten Larry-Brent-Folge 'Das Totenhaus der Lady Florence' eine alte Villa, die seit dem Tod von Lady Florence leer steht. Angeblich will er dort seinen neuesten Thriller vollenden, doch dies ist nur eine Scheintätigkeit. In Wahrheit hat er ein gefährliches Serum entwickelt, welches unsichtbar macht, allerdings auch noch eine tödliche Nebenwirkung aufweist. Jetzt sind jedoch die verschiedensten Agentenringe hinter ihm her.
Sehr spannende Geschichte, die genüsslich mit altbewährten Genre-Klischees spielt: Von unterbelichteten aber gutmütigen Totengräbern, einem schusseligen Professor (quiekt munter durch die Gegend: Joachim Wolff, der sich bereits als Professor Bienlein in Tim & Struppi akademische Sprechersporen verdient hat) bis zu einem offenherzigen, naiven und natürlich attraktiven Hippie-Mädchen reicht diesmal die Palette der von Shocker geschickt inszenierten Charaktere.
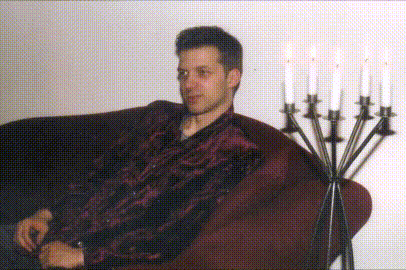 Der junge und recht attraktive Lord von Blackwood-Castle geht in der achten Larry-Brent-Folge 'Das Grauen von Blackwood-Castle' einem unappetitlichen Hobby nach: Er züchtet unzählige große und zum Teil sogar fleischfressende Raupen in den unterirdischen Gewölben seines Schlosses. Erbschleicher haben es zudem auf sein Vermögen abgesehen und fühlen sich daher gestört als sich eine junge Frau für den kauzigen Lord interessiert. Da kommen ihnen die aggressiven Geschöpfe des jungen Mannes gerade recht...
Der junge und recht attraktive Lord von Blackwood-Castle geht in der achten Larry-Brent-Folge 'Das Grauen von Blackwood-Castle' einem unappetitlichen Hobby nach: Er züchtet unzählige große und zum Teil sogar fleischfressende Raupen in den unterirdischen Gewölben seines Schlosses. Erbschleicher haben es zudem auf sein Vermögen abgesehen und fühlen sich daher gestört als sich eine junge Frau für den kauzigen Lord interessiert. Da kommen ihnen die aggressiven Geschöpfe des jungen Mannes gerade recht...
Gekonnt wird bis zum Schluss des Hörspiels die Spannung aufrecht erhalten, was es denn mit dem leicht gestörten Lord eigentlich auf sich hat. Helmut Zierl setzt den widersprüchlichen Charakter glaubwürdig in Szene. An dieser Stelle sei jedoch auch einmal erwähnt, dass der inflationäre Einsatz des `Mr. EUROPA´ alias F.J. Steffens als Dauer-Bösewicht in den beiden Shocker-Serien ein wenig penetrant wirkt.
|
REZENSION LARRY BRENT 9 und 10
Rache ist nicht immer süß
 Der missgebildete Dr. Gorgo, ein exzellenter Chirurg, rächt sich in der neunten Larry-Brent-Folge 'Die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo' an den Frauen, die ihn wegen seiner körperlichen Deformation in seinen Jugendjahren abgewiesen haben. Er lockt deren Töchter in sein Labor und verunstaltet sie dort, indem er ihre Köpfe auf die Körper von Tieren verpflanzt. Der missgebildete Dr. Gorgo, ein exzellenter Chirurg, rächt sich in der neunten Larry-Brent-Folge 'Die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo' an den Frauen, die ihn wegen seiner körperlichen Deformation in seinen Jugendjahren abgewiesen haben. Er lockt deren Töchter in sein Labor und verunstaltet sie dort, indem er ihre Köpfe auf die Körper von Tieren verpflanzt.
Eine grausame und abartige Handlung, bei der Jürgen Grasmück sein Talent für das rechte Maß bei Horrorgeschichten bedauerlicherweise abhanden gekommen ist. Auch Drehbuchschreiber Douglas Welbat und sein Schreiber-Team konnten ihrer Verantwortung, die sie gegenüber den de-facto überwiegend jugendlichen Konsumenten der Serie trugen, nach Meinung der HÖRSPIELer leider nicht gerecht werden. Die Folge war 1986, dass diese Hörspielepisode indiziert wurde und EUROPA danach alle Grusel- bzw. Horrorserien einstellte. Der Umstand, dass im Jahr 2024, 38 Jahre später, Jugendliche durch die massenmediale Verflachung und Verrohung, die aus der Privatisierungswelle des Fernsehens seit den späten 80ern resultiert, ohne viel Aufwand wesentlich bedenklichere Inhalte konsumieren können, ist hier nicht wirklich tröstlich.
 In Spanien entführt ein uraltes und mysteriöses Gefährt Menschen auf eine Burg, auf der sie vorzeitig altern und einem jahrhundertealten Tyrannen ihre Lebenskraft abtreten müssen. Doch der unsterbliche Herrscher will in der zehnten Larry-Brent-Folge 'Die Jenseitskutsche von Diablos' mehr: Er zwingt den amerikanischen Urenkel seines Henkers aus längst vergangenen Zeiten nach Spanien zu kommen, um sich dort stellvertretend an dem Jugendlichen rächen zu können.
In Spanien entführt ein uraltes und mysteriöses Gefährt Menschen auf eine Burg, auf der sie vorzeitig altern und einem jahrhundertealten Tyrannen ihre Lebenskraft abtreten müssen. Doch der unsterbliche Herrscher will in der zehnten Larry-Brent-Folge 'Die Jenseitskutsche von Diablos' mehr: Er zwingt den amerikanischen Urenkel seines Henkers aus längst vergangenen Zeiten nach Spanien zu kommen, um sich dort stellvertretend an dem Jugendlichen rächen zu können.
Typisch für Dan Shocker, dass er in die turbulente Handlung noch leger die Rolle eines Behinderten einbaut. Obwohl diese Figur als weder eindeutig gut noch eindeutig böse eingestuft werden kann, wäre diese Vorgehensweise Grasmücks Anno 2024 (also etwa 50 Jahre nach Erscheinen der Romane) wegen gewisser vermeintlicher Moralapostel dieser Tage wohl nicht mehr möglich.
|
REZENSION LARRY BRENT 11, 12 und 13
Geister, Gangster und Atome

 Ein irisches Fischerdorf wird in 'Sylphidas Rachegeister' von unheimlichen Fabelwesen terrorisiert: Die Sylphiden fordern vom Lord of Glophtony den für sie lebensnotwendigen Lohn eines jahrhundertealten Paktes mit dessen Vorfahren. Doch der Lord will die Sylphiden vernichten, was diese jedoch mit drastischen Mitteln zu verhindern suchen. Ein irisches Fischerdorf wird in 'Sylphidas Rachegeister' von unheimlichen Fabelwesen terrorisiert: Die Sylphiden fordern vom Lord of Glophtony den für sie lebensnotwendigen Lohn eines jahrhundertealten Paktes mit dessen Vorfahren. Doch der Lord will die Sylphiden vernichten, was diese jedoch mit drastischen Mitteln zu verhindern suchen.
Eine temporeiche, spannende Geschichte, die weitgehend ohne die Darstellung von Gewalt auskommt. Im Hörspiel wird der Countdown, gegen den Larry Brent ankämpfen muss, weniger glaubwürdig als vielmehr äußerst unbarmherzig geschildert. Das softeste Hörspiel nach Dan Shocker.
Um einen Kumpanen aus dem Gefängnis freizupressen, wollen einige Ganoven in der zwölften Larry-Brent-Folge 'Atomgespenster' die Öffentlichkeit mit der Wiederinbetriebnahme des Unglücksreaktors im amerikanischen Mealburg erpressen. Sie ahnen hierbei nicht, dass sich ihre Pläne mit denen eines zwielichtigen Arztes und einiger verstrahlter kindlicher Mutanten kreuzen.
Im Hörspiel erweisen sich die vermeintlichen Strahlenopfer bzw. -monster als einigen ihrer gesunden Mitbürger moralisch überlegen. Der Chuzpe dieser spannenden Geschichte, die eine düstere Atmosphäre entwickelt, liegt in der vollkommenen Selbstverständlichkeit, mit der Grasmück die Atomkraft der Siebziger Jahre als große Gefahr darstellt. Dies bedarf für ihn offenbar überhaupt keiner Erklärung.
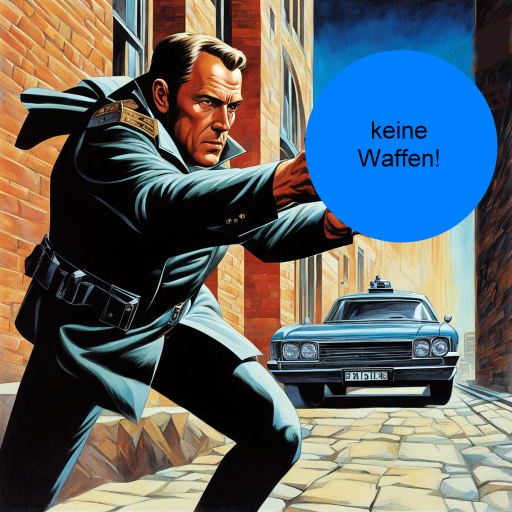 Larry Brents Freund Iwan Kunaritschew wird in eine mafiöse New Yorker Untergrundorganisation eingeschleust, deren Mitglieder Totenschädelmasken tragen. Die PSA vermutet in der dreizehnten Larry-Brent-Folge 'Der Dämon mit den Totenaugen', dass der Chef dieser Organisation über übernatürliche Kräfte verfügt. Schnell gerät auch Larry Brent in seine Gewalt.
Larry Brents Freund Iwan Kunaritschew wird in eine mafiöse New Yorker Untergrundorganisation eingeschleust, deren Mitglieder Totenschädelmasken tragen. Die PSA vermutet in der dreizehnten Larry-Brent-Folge 'Der Dämon mit den Totenaugen', dass der Chef dieser Organisation über übernatürliche Kräfte verfügt. Schnell gerät auch Larry Brent in seine Gewalt.
Neben der nervenaufreibenden Handlung sind es in dieser Folge wieder einmal die tragischen Nebenrollen, die der Story zu einer in diesem Genre selten anzutreffenden Tiefe verhelfen: Ein Cop, den kurz vor seiner Pensionierung noch der Tod ereilt und eine drogensüchtige Prostituierte (unerwartet überzeugend dargestellt von Renate Pichler, die sonst eher auf die Rolle der Familienmutter abonniert ist) machen Larry Brent die Erledigung seines Jobs nicht leichter...
|
REZENSION LARRY BRENT 14 und 15
Von Heuchlern und Meuchlern
 In einem geschlossenen und sehr restriktiv geleiteten spanischen Heim für schwer erziehbare junge Mädchen werden in der vierzehnten Larry-Brent-Vertonung 'Der Mönch mit der Teufelskralle' zwei der Insassen umgebracht. Die Anstaltsleitung will die Vorfälle am liebsten vertuschen, da sie selber in die Vorgänge verwickelt zu sein scheint. Dass Larry Brent in das Geschehen eingreift, stößt daher auf wenig Gegenliebe, geschweige denn Unterstützung.
In einem geschlossenen und sehr restriktiv geleiteten spanischen Heim für schwer erziehbare junge Mädchen werden in der vierzehnten Larry-Brent-Vertonung 'Der Mönch mit der Teufelskralle' zwei der Insassen umgebracht. Die Anstaltsleitung will die Vorfälle am liebsten vertuschen, da sie selber in die Vorgänge verwickelt zu sein scheint. Dass Larry Brent in das Geschehen eingreift, stößt daher auf wenig Gegenliebe, geschweige denn Unterstützung.
Die Darstellung der heuchlerischen Doppelmoral konservativer Anstaltsleiter ist zwar zu begrüßen, ansonsten geriet die Story jedoch ausgesprochen düster ohne wenigstens irgendwo einen minimalen Lichtblick erkennen zu lassen.  Die unvergessliche Marianne Kehlau gibt hierbei eine überzeugend bigotte Anstaltsmatrone ab. Zum Glück gibt es im modernen Europa heutzutage nur noch wenige geschlossene Heime für schwer erziehbare Jugendliche. Dennoch ist das Thema eigentlich etwas zu heikel für einen Grusel-Thriller à la Dan Shocker. Die unvergessliche Marianne Kehlau gibt hierbei eine überzeugend bigotte Anstaltsmatrone ab. Zum Glück gibt es im modernen Europa heutzutage nur noch wenige geschlossene Heime für schwer erziehbare Jugendliche. Dennoch ist das Thema eigentlich etwas zu heikel für einen Grusel-Thriller à la Dan Shocker.
Außerirdische haben in der fünfzehnten und letzten Larry-Brent-Folge 'Dämonenbrut' menschlichen Müttern ihre Nachkommenschaft untergejubelt. Mit Erreichen ihres 5. Lebensjahres werden die bis dahin unauffälligen Kinder jedoch zu übermächtigen, gewalttätigen Mutanten, die die Erde zusammen mit einigen menschlichen Versuchskaninchen verlassen wollen.
Prinzipiell eine recht gute SF-Gruselstory mit stimmiger Achtziger-Jahre-Synthesizer-Untermalung. Der spannende Handlungsablauf wird ergänzt durch eine gelungene und eine fatale Nebenrollenbesetzung: Glücklich war die Verpflichtung Hans Clarins als selbstherrlicher Psychoanalytiker, unterirdisch geriet stimmenlagentechnisch jedoch die Darstellung des außerirdischen Anführerkindes, welche dem Hörer die zweite Hälfte des Hörspiels leider völlig vergrätzt. Larry Brent ist eben doch ein viel zu irdischer Haudegen als dass er ernsthaft auch als Science-Fiction-Held überzeugen könnte.
|
REZENSION LARRY BRENT 16 und 17
Grauenhafter Neustart
 Die vier Neuvertonungen von 2003 der legendären Larry-Brent-Serie aus den Achtziger Jahren können leider nicht überzeugen: Die vier Neuvertonungen von 2003 der legendären Larry-Brent-Serie aus den Achtziger Jahren können leider nicht überzeugen:
Eine Albina aus Neu-Guinea will sich am postkolonialen Europa für vergangenes Unrecht an ihrer Heimat rächen, indem sie Verstorbene auf den Friedhöfen wieder zum Leben erweckt und mit ihrer wachsenden Untoten-Armee den Kontinenten lahmlegt. Die Story um Orungu, Fratze Aus Dem Dschungel, ist hanebüchener als die Umsetzung, die einigermaßen solide, aber nicht eben sehr spannend geriet.
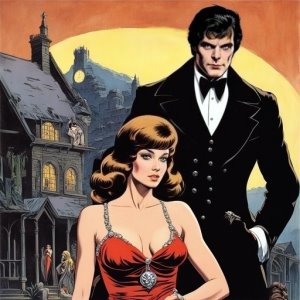 Die Geschichte um einen Untoten, der in einem verlassenen Wiener Palais junge schöne Frauen (leider jeweils mit schrecklich unästhetischen Stimmen) ein prachtvolles Kleid anprobieren lässt, das sie binnen kurzer Zeit um Jahrzehnte altern lässt, rangiert vom Gruselfaktor nur leicht über den Hui-Buh-Hörspielen nach Eberhard Alexander-Burgh oder thematisch noch passender `die Hexe Schrumpeldei´. Zwar wartet das Schwarze Palais von Wien mit einigen Trümpfen bei den Sprechern dieser Mäntelein-Wechsel-Dich-Vertonung auf - neben dem ansonsten großartigen Gerd Baltus durfte auch Astrid Kollex alias die Original-Hexe-Marina aus dem legendären `Chopper - Geisterstimme aus dem Jenseits´-Hörspiel ein paar Flüche vom Stapel lassen - aber auch mit dieser Neuproduktion nach einem Roman von Jürgen Grasmück wurde einmal mehr deutlich, dass mindestens die Hälfte des Erfolgs der Larry-Brent-Serie auf die unglaublich stimmungsvolle Musikuntermalung des vom Europa-Label geschassten Carsten Bohn zuruckzuführen gewesen sein dürfte, die bei den neuen Stücken einfach sehr schmerzhaft fehlt. Einen witzigen Bonus gab es dann aber doch als musikalische Anreicherung der Kaffeehausszenen: die witzigen schwulen musikalischen Schwärmereien nach Noten (`Ach duuu´) aus den späten sechziger Jahren inklusive dem Evergreen `O-na-nie, o-na-no´. Die Geschichte um einen Untoten, der in einem verlassenen Wiener Palais junge schöne Frauen (leider jeweils mit schrecklich unästhetischen Stimmen) ein prachtvolles Kleid anprobieren lässt, das sie binnen kurzer Zeit um Jahrzehnte altern lässt, rangiert vom Gruselfaktor nur leicht über den Hui-Buh-Hörspielen nach Eberhard Alexander-Burgh oder thematisch noch passender `die Hexe Schrumpeldei´. Zwar wartet das Schwarze Palais von Wien mit einigen Trümpfen bei den Sprechern dieser Mäntelein-Wechsel-Dich-Vertonung auf - neben dem ansonsten großartigen Gerd Baltus durfte auch Astrid Kollex alias die Original-Hexe-Marina aus dem legendären `Chopper - Geisterstimme aus dem Jenseits´-Hörspiel ein paar Flüche vom Stapel lassen - aber auch mit dieser Neuproduktion nach einem Roman von Jürgen Grasmück wurde einmal mehr deutlich, dass mindestens die Hälfte des Erfolgs der Larry-Brent-Serie auf die unglaublich stimmungsvolle Musikuntermalung des vom Europa-Label geschassten Carsten Bohn zuruckzuführen gewesen sein dürfte, die bei den neuen Stücken einfach sehr schmerzhaft fehlt. Einen witzigen Bonus gab es dann aber doch als musikalische Anreicherung der Kaffeehausszenen: die witzigen schwulen musikalischen Schwärmereien nach Noten (`Ach duuu´) aus den späten sechziger Jahren inklusive dem Evergreen `O-na-nie, o-na-no´.
|
REZENSION LARRY BRENT 18 und 19
Killer-Dialoge aus dem Dilettanten-Nirvana
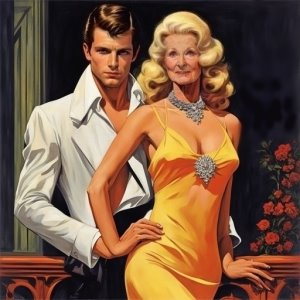
 Das Verwirrspiel um eine Schreckensparty bei Graf Dracula kann immerhin mit Lutz Mackensy in einer Nebenrolle im allgemeinen Tohuwabohu aufwarten. Die Story um eine immer mehr zum Vampir-Massaker abgleitenden Party hätte ein gewisses Spannungspotential entfalten können, wären da nicht die völlig unnatürlich und gesteltzt wirkenden Dialoge, die die Hörer fortwährend daran erinnern, dass man es hier mit dem hilflosen dritten Versuch zu tun hat, eine ehemals sexy Serie aus der Versenkung zu heben. Das Verwirrspiel um eine Schreckensparty bei Graf Dracula kann immerhin mit Lutz Mackensy in einer Nebenrolle im allgemeinen Tohuwabohu aufwarten. Die Story um eine immer mehr zum Vampir-Massaker abgleitenden Party hätte ein gewisses Spannungspotential entfalten können, wären da nicht die völlig unnatürlich und gesteltzt wirkenden Dialoge, die die Hörer fortwährend daran erinnern, dass man es hier mit dem hilflosen dritten Versuch zu tun hat, eine ehemals sexy Serie aus der Versenkung zu heben.
Bei der Forschung um biologische Waffen werden Makroviren freigesetzt, die zunächst einzelnen Menschen und später einer ganzen Stadt den Garaus machen. Das Stück um den Killervirus aus der Hölle liefert den unfreiwilligen Beweis dafür, dass verlängerte Spielzeiten aufgrund besserer technischer Speichermedien keineswegs ein Segen für moderne Hörspielproduktionen sein müssen, wenn sie denn nicht gleichzeitig mit einem temporeichen Drehbuch und einer virilen Regiearbeit einhergehen.
 Die Dialoge wirken teilweise extrem gekünstelt: Eine Studentin, deren Professor gerade erst bei einem tragischen Autounfall um´s Leben kam, würde im privaten Rahmen wohl kaum Sätze formulieren, wie "Mehrere Male hatte ich Gelegenheit unter Anleitung von Professor Tanner in dessen Institut an Versuchen teilzunehmen. (...) Und doch trifft mich sein Schicksal persönlich." Der Erzähler schien den vorliegenden Text leider mit einer Gute-Nacht-Geschichte für Kinder zu verwechseln und von der Regie in diesem Irrtum nicht korrigiert worden zu sein. Der Ganove klingt nicht annähernd so überzeugend gefährlich wie beispielsweise Horst Frank oder Gottfried Kramer, die leider, leider für diese Produktion nicht mehr zur Verfügung standen. Spannung kommt beim lustlosen Spiel der merkwürdig unbeteiligt wirkenden Sprecher nur an wenigen Stellen auf, da kann selbst Schauspiel-Legende Jürgen Thormann nicht helfen. Immerhin wurde bei der Realisation des Grasmück-Romans auf den für neuere Produktionen leider so typischen Einsatz von dauermusikalischer Untermalung verzichtet. Die Kollegen von `Dudelstopp´ dürften dies durchaus mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Die Dialoge wirken teilweise extrem gekünstelt: Eine Studentin, deren Professor gerade erst bei einem tragischen Autounfall um´s Leben kam, würde im privaten Rahmen wohl kaum Sätze formulieren, wie "Mehrere Male hatte ich Gelegenheit unter Anleitung von Professor Tanner in dessen Institut an Versuchen teilzunehmen. (...) Und doch trifft mich sein Schicksal persönlich." Der Erzähler schien den vorliegenden Text leider mit einer Gute-Nacht-Geschichte für Kinder zu verwechseln und von der Regie in diesem Irrtum nicht korrigiert worden zu sein. Der Ganove klingt nicht annähernd so überzeugend gefährlich wie beispielsweise Horst Frank oder Gottfried Kramer, die leider, leider für diese Produktion nicht mehr zur Verfügung standen. Spannung kommt beim lustlosen Spiel der merkwürdig unbeteiligt wirkenden Sprecher nur an wenigen Stellen auf, da kann selbst Schauspiel-Legende Jürgen Thormann nicht helfen. Immerhin wurde bei der Realisation des Grasmück-Romans auf den für neuere Produktionen leider so typischen Einsatz von dauermusikalischer Untermalung verzichtet. Die Kollegen von `Dudelstopp´ dürften dies durchaus mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. |
Die o.g. Hörspiele scheinen für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ungeeignet.
|

Übrigens ...
Tom und Eileen Fawley
Im Jahr 1988 gab sich das kongeniale Schauspieler- und vor allem Hörspielsprecher-Ehepaar Horst Frank und Brigitte Kollecker-Frank ein Stelldichein im SWF-Hörspielkrimi 'Der Joker' nach Motiven von Edgar Wallace und erinnert dabei natürlich gewollt an seine gemeinsamen Paraderollen als 'Tom und Eileen Fawley' in den legendären Neon-Grusel-Hörspielen eines Hamburger Unterhaltungslabels Anfang der Achtziger Jahre. Leider hatte der solide vertonte Hörspielzweiteiler im Vergleich zu den gerade bei Jugendlichen damals deutlich populäreren neonfarbig gehaltenen Produktionen wenig Biss.
Sehr viel Spezialwissen und oftmals interessante Gedanken zur Gruselserie von H. G. Francis gibt es auf den Gruselseiten zu entdecken.
|
REZENSION NEON GRUSEL 01
Frankensteins Sohn im Monster-Labor     
  Die erste Folge der „Neon-Grusel-Serie“, „Frankensteins Sohn im Monster-Labor“, von H.G. Francis markiert den Auftakt einer legendären Hörspielreihe, die gleichermaßen Begeisterung wie Kritik auf sich zog. Als selbstständiges Hörspiel in den späten 1970ern erschienen, wurde es 1981 in die ikonische Gruselserie integriert und spiegelt die popkulturelle Faszination für klassische Horrorthemen wider.
Die erste Folge der „Neon-Grusel-Serie“, „Frankensteins Sohn im Monster-Labor“, von H.G. Francis markiert den Auftakt einer legendären Hörspielreihe, die gleichermaßen Begeisterung wie Kritik auf sich zog. Als selbstständiges Hörspiel in den späten 1970ern erschienen, wurde es 1981 in die ikonische Gruselserie integriert und spiegelt die popkulturelle Faszination für klassische Horrorthemen wider.
Die Geschichte handelt von den Reportern Maggie und Bob Brown, die von Dr. Giralda auf dessen unheimliche Burg eingeladen werden. Dort werden sie Zeugen experimenteller Wissenschaft, die letztlich Dr. Frankensteins Erbe weiterführt. Die Handlung spielt mit klassischen Horrorversatzstücken wie düsteren Burgen, geheimnisvollen Experimenten und moralischen Fragen zu Wissenschaft und Ethik. In der Ausführung jedoch spalten sich die Meinungen: Kritiker bemängeln fehlende Spannung und logische Brüche, während Befürworter die Atmosphäre und die Sprecherleistungen hervorheben.
Ein wiederkehrender Kritikpunkt ist die Struktur der Handlung, die durch einige unlogische Wendungen an Kohärenz verliert. Die Charaktere Bob und Maggie werden teils über die Geschehnisse informiert, teils außen vor gelassen, was den Plot geheimnisvoll, aber auch verwirrend macht. Zudem wirkt die Figur des Dr. Frank ambivalent – eine Mischung aus wahnsinnigem Wissenschaftler und bemitleidenswertem Opfer eigener Experimente. Hans Paetsch, bekannt als Märchenerzähler, verleiht Dr. Frank eine tragische Tiefe, die den Hörern in Erinnerung bleibt.
Die Sprecherbesetzung ist insgesamt gut gelungen: Gerd Martienzen und Eva Gelb, ein Ehepaar auch im realen Leben, brillieren als dynamisches Duo. Ihre Dialoge verleihen dem Hörspiel eine humorvolle Note, die dem Grusel einen ironischen Unterton hinzufügt. Dennoch bleibt die erste Folge in Bezug auf Dialogwitz und Intensität hinter späteren Episoden mit dem Duo Tom Fawley und Eireen Fox zurück.
Musikalisch präsentiert sich die Episode mit einem markanten Synthesizer-Soundtrack, der polarisiert. Die Mischung aus Funk und Horror wird als „herrlich schräg“ beschrieben, trägt aber wenig zur gruseligen Atmosphäre bei. Insbesondere in der Neuauflage der 2000er-Jahre wird die moderne musikalische Untermalung oft als deplatziert empfunden.
Trotz ihrer Schwächen besitzt die Folge einen besonderen Kultstatus, nicht zuletzt durch nostalgische Erinnerungen der Hörer. „Frankensteins Sohn im Monster-Labor“ lädt ein, die Hörspielepoche der 1970er und 1980er Jahre durch eine andere Linse zu betrachten – als eine Zeit, in der die Fantasie die visuelle Dominanz der Popkultur noch nicht übertroffen hatte. Die Gruselserie zeigt, wie tief die Verbindung von akustischem Erzählen und popkulturellen Motiven reichen kann. |
REZENSION NEON GRUSEL 02
Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten     
  Das Hörspiel "Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten", die zweite Folge der von H.G. Francis geschriebenen „Neon-Grusel-Serie“, kombiniert klassische Horror-Ikonen auf eine außergewöhnliche Weise. In der Produktion treffen Dracula und Frankenstein, die berühmten Schöpfungen von Bram Stoker und Mary Shelley, zwar nicht direkt aufeinander, dennoch werden ihre Geschichten auf einer düsteren erzählerischen Bühne verwoben.
Das Hörspiel "Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten", die zweite Folge der von H.G. Francis geschriebenen „Neon-Grusel-Serie“, kombiniert klassische Horror-Ikonen auf eine außergewöhnliche Weise. In der Produktion treffen Dracula und Frankenstein, die berühmten Schöpfungen von Bram Stoker und Mary Shelley, zwar nicht direkt aufeinander, dennoch werden ihre Geschichten auf einer düsteren erzählerischen Bühne verwoben.
Das Hörspiel punktet mit seiner dichten Atmosphäre, die durch ein hervorragend besetztes Sprecherensemble unterstrichen wird. Insbesondere Horst Frank und Brigitte Kollecker, die das Reporterpaar Tom Fawley und Eireen Fox verkörpern, tragen maßgeblich zur Dynamik und zum Unterhaltungswert bei. Ihre Dialoge balancieren geschickt zwischen Grusel und subtilem Humor. Auch Hans Paetsch als Dr. Stein, der Interpretation von Frankenstein, bringt die notwendige Gravitas in seine Rolle, wenngleich einige Kritiker seine Darstellung als zu wenig bedrohlich empfanden.
Die Handlung ist in einer unheimlichen, nebligen Szenerie verankert und vereint typische Motive klassischer Horrorstoffe: ein abgelegenes Schloss, morbide Experimente und die Bedrohung durch dunkle Mächte. Trotz einer Fülle von Logikfehlern – etwa der schwer nachvollziehbaren Mixtur aus Vampir- und Frankenstein-Mythos – bleibt das Hörspiel durch seine narrative Unberechenbarkeit und charmanten Trash-Faktor ein zeitloser Klassiker. Der kreative, aber teils abenteuerliche Umgang mit den literarischen Vorlagen sorgt für Diskussionen unter Hörspiel-Fans: Während einige das Werk als kultigen Hexenkessel beschreiben, der bewusst Genre-Klischees persifliert, kritisieren andere den Verlust der originalen düsteren Ernsthaftigkeit.
Besonders hervorzuheben ist die Figur der Dr. Finistra, deren dämonisches Lachen und finstere Intrigen eine verstörende Präsenz schaffen. Sie avanciert zur eigentlichen Antagonistin des Stücks und verleiht der Geschichte zusätzliche Tiefe. Der Einsatz von Musik und Geräuschen ist stimmungsvoll, auch wenn in späteren Überarbeitungen Originaluntermalungen entfernt wurden, was nostalgische Fans bemängeln.
Trotz oder gerade wegen seiner Schwächen bleibt "Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten" ein Kultstück, das seine Hörer mit seiner unorthodoxen Erzählweise fesselt. Es zeigt, wie popkulturelle Mythen durch Adaptionen weiterleben und sich im Medium des Hörspiels auf erfrischend neue Weise präsentieren lassen. |
REZENSION NEON GRUSEL 03
Dracula, König der Vampire     
  Das Hörspiel „Dracula, König der Vampire“, die dritte Folge der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis, bietet eine atmosphärisch dichte, aber stark verkürzte Adaption von Bram Stokers Roman. Mit einer Spielzeit von knapp 40 Minuten konzentriert sich das Werk auf die frühen Kapitel der Vorlage, insbesondere Jonathan Harkers Aufenthalt im Schloss des Grafen Dracula. Dabei weicht die Handlung bewusst von der Romanvorlage ab, was dem Hörspiel sowohl Vor- als auch Nachteile beschert.
Das Hörspiel „Dracula, König der Vampire“, die dritte Folge der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis, bietet eine atmosphärisch dichte, aber stark verkürzte Adaption von Bram Stokers Roman. Mit einer Spielzeit von knapp 40 Minuten konzentriert sich das Werk auf die frühen Kapitel der Vorlage, insbesondere Jonathan Harkers Aufenthalt im Schloss des Grafen Dracula. Dabei weicht die Handlung bewusst von der Romanvorlage ab, was dem Hörspiel sowohl Vor- als auch Nachteile beschert.
H.G. Francis entschied sich, Harker von Anfang an von seiner Verlobten Mina begleiten zu lassen. Dieser dramaturgische Kunstgriff ermöglicht lebhaftere Dialoge und stärkt die Erzählstruktur, indem Monologe vermieden werden. Puristen könnten dies jedoch als Verrat an der Vorlage sehen, da dadurch zentrale Figuren wie Van Helsing und spätere Handlungsstränge komplett ausgespart bleiben. Stattdessen liegt der Fokus auf einer unheimlichen, beklemmenden Atmosphäre, die das Schloss als klaustrophobischen Mikrokosmos für Draculas bedrohliche Präsenz etabliert.
Die Besetzung ist wohl die einzige Stärke dieser Produktion. Charles Regnier überzeugt als ambivalenter Graf Dracula, dessen Stimme zwischen kultivierter Höflichkeit und unterschwelliger Bedrohlichkeit changiert. Günther Ungeheuer als Jonathan Harker wirkt hingegen für manche Kritiker stimmlich zu reif, um den jungen Anwalt überzeugend zu verkörpern. Doch seine Leistung als Erzähler verleiht dem Hörspiel eine gewisse Gravitas, die die eher stringente Handlung aufwertet. Reinhilt Schneiders Darstellung Minas bringt die Naivität und Angst ihrer Figur glaubwürdig zur Geltung.
Der Versuch, den Roman für das Hörspielmedium zu adaptieren, ist jedoch nicht ohne Schwächen. Die Kürzung führt zu logischen Sprüngen und einer stark vereinfachten Charakterzeichnung. Draculas komplexe Dualität als Verführer und Monster bleibt hier weitgehend ungenutzt. Auch die völlige Abwesenheit von Humor oder wenigstens ironischen Untertönen machen das Stück zu dem eindeutigen Träger der 'roten Laterne' der ansonsten recht amüsanten und kultigen Gruselserie. Für 'beinharte' Fans der Serie bleibt es ein nostalgischer Klassiker, der trotz oder gerade wegen seiner Abweichungen von der Vorlage einen eigenen Platz im Kanon der Dracula-Adaptionen behauptet.
|
REZENSION NEON GRUSEL 04
Das Schloss des Grauens     
  Das Hörspiel „Das Schloss des Grauens“, die vierte Folge der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis, gehört zu den prägnanten Beispielen einer nostalgischen Hörspielkultur, die sich durch dichte Atmosphäre und archetypische Erzählstrukturen auszeichnet. Veröffentlicht in den 1970er-Jahren, lebt das Werk von seinem klassischen Grusel-Setting: ein isoliertes Schloss in stürmischer Nacht, rätselhafte Geistererscheinungen und ein tragisches Liebesmotiv, das in düsteren Geheimnissen verwoben ist.
Das Hörspiel „Das Schloss des Grauens“, die vierte Folge der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis, gehört zu den prägnanten Beispielen einer nostalgischen Hörspielkultur, die sich durch dichte Atmosphäre und archetypische Erzählstrukturen auszeichnet. Veröffentlicht in den 1970er-Jahren, lebt das Werk von seinem klassischen Grusel-Setting: ein isoliertes Schloss in stürmischer Nacht, rätselhafte Geistererscheinungen und ein tragisches Liebesmotiv, das in düsteren Geheimnissen verwoben ist.
Die Geschichte um Benno und Ulla, die in einem alten Schloss Zuflucht suchen und sich mit unheimlichen Begebenheiten konfrontiert sehen, verbindet Elemente des Schauerromans mit popkulturellen Konventionen. Besonders hervorgehoben wird immer wieder die Leistung der Sprecher: Ernst von Klipsteins Darstellung des mysteriösen Wagner und Peter Kirchbergers markanter „Linda“-Ruf hinterlassen nachhaltige Eindrücke bei den Hörern. Die Abwesenheit eines Erzählers verstärkt die Unmittelbarkeit der Ereignisse, wodurch die Zuhörer stärker in die Handlung eingebunden werden.
Kritische Stimmen bemängeln jedoch die vorhersehbare Handlung und klischeebeladene Elemente wie nicht funktionierende Telefone und unpassierbare Wege. Die musikalische Untermalung wird ambivalent bewertet: Während die originale Vertonung von einigen als stilvoll und atmosphärisch empfunden wird, stößt die später eingefügte, teils kitschige Musik auf Kritik. Ebenso polarisiert die Figur der Ulla, deren hysterisches Verhalten als überzeichnet empfunden wird, während andere es als realistischen Kontrast zur kühlen Gelassenheit ihres Mannes Benno verteidigen.
Ungeachtet dessen bleibt „Schloss des Grauens“ für viele ein Meilenstein in der kommerziellen Hörspielgeschichte. Seine besondere Mischung aus Grusel, Humor und Romantik verleiht der Produktion Kultstatus, und gerade die nostalgische Wirkung sorgt bis heute für Anerkennung. Die Kombination aus dem tragischen Schicksal des Geistes Georg, der weiterhin nach seiner Linda ruft, und den liebevoll inszenierten Schauplatzdetails schafft eine durchaus zeitlose Hörerfahrung über 'die Jahrhunderte' hinweg.
|
REZENSION NEON GRUSEL 05
Der Angriff der Horrorameisen     
  Die fünfte Folge der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis, „Der Angriff der Horrorameisen“, gehört zu den ikonischeren Beiträgen der Reihe. Sie ist ein Beispiel dafür, wie Science-Fiction und Horror der 1950er- und 60er-Jahre in die deutsche Hörspielwelt der 1980er integriert wurden. Offensichtliche Anleihen beim amerikanischen Filmklassiker „Formicula“ (1954) sind ebenso Teil der DNA dieser Geschichte wie die Atmosphäre der Schwarz-Weiß-B-Movies dieser Ära. Doch was macht diese Folge so erinnerungswürdig – oder, für manche, so ernüchternd?
Die fünfte Folge der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis, „Der Angriff der Horrorameisen“, gehört zu den ikonischeren Beiträgen der Reihe. Sie ist ein Beispiel dafür, wie Science-Fiction und Horror der 1950er- und 60er-Jahre in die deutsche Hörspielwelt der 1980er integriert wurden. Offensichtliche Anleihen beim amerikanischen Filmklassiker „Formicula“ (1954) sind ebenso Teil der DNA dieser Geschichte wie die Atmosphäre der Schwarz-Weiß-B-Movies dieser Ära. Doch was macht diese Folge so erinnerungswürdig – oder, für manche, so ernüchternd?
Die Geschichte beginnt mit einem klassischen Szenario: Eine Autopanne in der Wüste Nevadas führt die Geschwister Harry und Joanne Marlow zu einer schrecklichen Entdeckung – zerstörte Gebäude und mumifizierte Leichen. Der Auftakt ist atmosphärisch dicht und lässt die Bedrohung der Riesenameisen spürbar werden, bevor sie erstmals auftreten. Doch gerade diese Zurückhaltung wird oft als Schwäche ausgelegt. Viele Hörer bemängeln, dass die Ameisen zu spät ins Spiel kommen und die Handlung dadurch an Spannung verliert. Was für einige ein Aufbau von Suspense ist, erscheint anderen als dramaturgische Lücke.
Die Hörspielproduktion selbst spiegelt den Charme ihrer Zeit wider. Die Sprecherleistungen von Günther Flesch und Ursula Sieg als streitendes Geschwisterpaar werden oft gelobt, wenngleich die Dynamik nicht an die legendären Fawley’schen Dialoge aus anderen Serienfolgen heranreicht. Wolfgang Völz’ Sheriff sorgt für humorvolle Momente, wirkt aber stellenweise überzeichnet. Die musikalische Untermalung, vor allem in der Originalfassung, wird als stimmungsvoll wahrgenommen, auch wenn spätere Remixes für Kontroversen sorgten. Der Erzählstil und die Effekte – etwa das Summen der Ameisen – schaffen eine bedrückende Atmosphäre, obwohl technische Unstimmigkeiten nicht zu überhören sind.
Kritik entzündet sich vor allem an der Logik der Handlung. Der Einsatz eines Tonbandgeräts, dessen Aufnahme die Ameisen in die Flucht schlägt, erscheint vielen als unglaubwürdig und konstruiert. Ebenso polarisiert die eindimensionale Darstellung der Riesenameisen, die zwar Bedrohung symbolisieren, aber wenig Tiefe oder metaphorischen Gehalt bieten. Statt einer Parabel auf die zerstörerische Macht des Menschen bleibt die Geschichte im Rahmen eines Tierhorrors, der mehr auf Unterhaltungswert als auf Botschaft setzt.
Trotz aller Schwächen hat die Folge einen festen Platz in der Nostalgie vieler Fans. Sie erinnert an die kindliche Freude am Gruseln und an eine Ära, in der Hörspiele ein populäres Medium für Abenteuer und Schrecken waren. Für manche bleibt sie ein Highlight, für andere ein schwacher Moment in einer kultigen Serie – doch eines ist unbestritten: „Der Angriff der Horrorameisen“ bleibt ein markanter popkultureller Zeitzeuge.
|
REZENSION NEON GRUSEL 06
Das Duell mit dem Vampir     
  Das Hörspiel "Das Duell mit dem Vampir", die sechste Folge der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis, ist eine Produktion, die bis heute für intensive Diskussionen unter Hörspielfeeunden sorgt. Mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Vampir- und Werwolfmythologie und einem düsteren Ende hebt sie sich deutlich von den typischen Gruselgeschichten ihrer Zeit ab.
Das Hörspiel "Das Duell mit dem Vampir", die sechste Folge der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis, ist eine Produktion, die bis heute für intensive Diskussionen unter Hörspielfeeunden sorgt. Mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Vampir- und Werwolfmythologie und einem düsteren Ende hebt sie sich deutlich von den typischen Gruselgeschichten ihrer Zeit ab.
Die Handlung folgt dem bekannten Reporterduo Tom Fawley und Eireen Fox, die diesmal in ein unheilvolles Abenteuer in einem spanischen Hotel verstrickt werden. Hier treffen sie auf die geheimnisvolle Señorita Alvarez, einen Werwolf und einen düsteren Doktor. Die Spannung wird durch die wechselnden Rollen und Ambitionen der Charaktere sowie zahlreiche Wendungen vorangetrieben, doch nicht alle Fragen werden beantwortet. Gerade diese offenen Punkte – etwa die Bedeutung einer Doppelgängerin oder die vampirischen Transformationen – sorgen für einigen Missmut bei Hörern.
Einige preisen diese Episode als atmosphärisch dichtes Meisterwerk, das durch Sprecherleistungen wie die von Horst Frank und Brigitte Kollecker sowie die düstere Musik von Carsten Bohn zu überzeugen weiß. Die Eröffnungsszene im Auto und die späteren Konfrontationen mit den übernatürlichen Wesen gelten als Höhepunkte des Grusels.
Andere kritisieren jedoch die Logik der Geschichte, die teils holprig wirkt. Etwa der „kitzelige Werwolf“ oder die Frage, warum Alvarez zunächst eine Opferrolle einnimmt, bevor sie sich als Vampirin offenbart, sorgen für Irritationen. Dennoch verteidigen einige Kommentatoren gerade diese Ungereimtheiten als typisch für das Genre und als bewusst eingesetzt, um Raum für eigene Interpretationen zu schaffen.
Besonders das Ende hat nachhaltigen Eindruck hinterlassen: Das Böse siegt, als Tom und Eireen zu Vampiren werden. Dieser mutige Schluss bricht mit dem sonst üblichen Schema des Happy Ends und erinnert an Roman Polanskis Film "Tanz der Vampire". Damit erhält die Episode eine apokalyptische Dimension, die sie aus der Serie herausstechen lässt.
"Das Duell mit dem Vampir" ist damit nicht nur ein exemplarisches Hörspiel seiner Ära, sondern auch ein Zeugnis dafür, wie das Unperfekte und die gezielte Verwirrung die Fantasie der Hörer anregen können. |
REZENSION NEON GRUSEL 07
Die Begegnung mit der Mörder-Mumie     
  Das Hörspiel "Die Begegnung mit der Mörder-Mumie", die siebte Folge der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis, öffnet ein erzählerisches Grab, das tief in den popkulturellen Archäologien des 20. Jahrhunderts wurzelt. Inspiriert von den ikonischen Universal-Mumienfilmen der 1930er Jahre, geht das Hörspiel über die klassische Darstellung der träge umherwankenden Kreatur hinaus und nutzt geschickt die Ägypten-Mythologie als Kulisse. Zwischen Sarkophagen, Oasen und verfluchten Amuletten entfaltet sich ein Hörspiel, das sich mit Klischees und Eigenständigkeit zugleich arrangiert.
Das Hörspiel "Die Begegnung mit der Mörder-Mumie", die siebte Folge der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis, öffnet ein erzählerisches Grab, das tief in den popkulturellen Archäologien des 20. Jahrhunderts wurzelt. Inspiriert von den ikonischen Universal-Mumienfilmen der 1930er Jahre, geht das Hörspiel über die klassische Darstellung der träge umherwankenden Kreatur hinaus und nutzt geschickt die Ägypten-Mythologie als Kulisse. Zwischen Sarkophagen, Oasen und verfluchten Amuletten entfaltet sich ein Hörspiel, das sich mit Klischees und Eigenständigkeit zugleich arrangiert.
Im Zentrum steht die Mumie Merikara, ein Pharaonensohn, der durch ein Missgeschick der Tochter eines Archäologen wiederbelebt wird. Dabei wird deutlich, wie Francis die narrative Struktur der Filme jener Ära aufgreift und variiert. Die Mumie ist weniger ein autonomer Schrecken als vielmehr der Avatar eines uralten Fluchs. Flankiert von den Reitern des Horus – untoten Wächtern - wird die Mythologie des alten Ägypten greifbar gemacht, auch wenn diese Elemente historisch wenig fundiert sind. Die Details, etwa ein lebender Schlangenstab oder das ominöse "Buch der Weisen", zielen mehr auf mystische Stimmung als auf historische Genauigkeit ab.
Trotz dieser gelungenen Atmosphäre bleibt die Geschichte narrativ stellenweise schwach. Die Charaktere wirken austauschbar; die Sprecherleistung hingegen wird als stark gelobt. Figuren wie der zweifach sterbende Ali oder die in ihrer Funktion unklare Figur des Muhammad sorgen für Verwirrung. Dies beeinträchtigt jedoch kaum die Wirkung des Stücks. Die Klangkulisse und Musik – oft hervorgehoben als integraler Teil der Gruselwirkung – tragen wesentlich zur Inszenierung bei. Die weibliche Protagonistin (glaubwürdig gesprochen von Heidi Schaffrath) agiert ausnahmsweise mal nicht hysterisch und unvernünftig, wie in vielen anderen Stücken ähnlicher Machart (z.B. 'Dale' in Flash Gordon).
"Die Begegnung mit der Mörder-Mumie" bleibt trotz der Schwächen eine atmosphärisch dichte Episode, die zwischen Popkultur und klassischem Schauerstück changiert. Francis verwebt Elemente aus Mumien- und Grabräuber-Mythen mit modernem Grusel. Trotz kritischer Stimmen bleibt Merikara ein unverwechselbarer Teil der Serie, dessen Ägypten-Schauer den Hörer in eine fremde Welt entführt, die ebenso vertraut wie fiktiv ist. |
REZENSION NEON GRUSEL 08
Gräfin Dracula, Tochter des Bösen     
  Das Hörspiel „Gräfin Dracula, Tochter des Bösen“ stellt die achte Folge der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis dar und verbindet klassische Horrormotive mit zeitgenössischen popkulturellen Anklängen. Die Produktion entstammt einer langen Tradition des Hörspiels, in dem alte Mythen neu interpretiert werden.
Das Hörspiel „Gräfin Dracula, Tochter des Bösen“ stellt die achte Folge der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis dar und verbindet klassische Horrormotive mit zeitgenössischen popkulturellen Anklängen. Die Produktion entstammt einer langen Tradition des Hörspiels, in dem alte Mythen neu interpretiert werden.
Der Text zeichnet sich durch einen gekonnten Mix aus Spannung, Ironie und kulturellen Referenzen aus, der sowohl Liebhaber des Genres als auch ein breiteres Publikum anspricht. Dabei gelingt es, die bekannten Elemente der Dracula-Legende in ein modernes Setting zu überführen, ohne den nostalgischen Charme vergangener Hörspielklassiker zu verlieren.
Die Atmosphäre des Hörspiels wird durch eine gelungene Kombination aus Soundeffekten, Musik und erzählerischem Feingefühl erzeugt. Die Klanglandschaften wirken dabei oft wie ein urbanes Labyrinth, das den Zuhörer in eine Welt zwischen Realität und Übernatürlichem entführt. Die bewusste Einbindung von Neon-Elementen und modernen Klangbildern schafft zudem eine Brücke zwischen dem Traditionellen und dem Zeitgenössischen.
 H.G. Francis gelingt es, bekannte Mythen in einen neuen Kontext zu setzen, der nicht nur auf Schockeffekte, sondern auch auf subtile Anspielungen und humorvolle Reflexionen der Popkultur setzt. Die Gräfin erscheint dabei nicht nur als Inbegriff des Übernatürlichen, sondern auch als Symbol für eine ambivalente Macht, die mit einer gewissen Ironie und Selbstreflexion präsentiert wird.
H.G. Francis gelingt es, bekannte Mythen in einen neuen Kontext zu setzen, der nicht nur auf Schockeffekte, sondern auch auf subtile Anspielungen und humorvolle Reflexionen der Popkultur setzt. Die Gräfin erscheint dabei nicht nur als Inbegriff des Übernatürlichen, sondern auch als Symbol für eine ambivalente Macht, die mit einer gewissen Ironie und Selbstreflexion präsentiert wird.
Es ist schön, "Commander Perkins" Horst Stark einmal weniger militärisch gedrillt, wie in 'Das Weltraum-Monster' oder noch schlimmer bei Perry Rhodan, zu hören - und Marianne Kehlau als Gräfin ist fraglos die Idealbesetzung für die ambivalente Figur der Gräfin Dracula.
Kritisch anzumerken ist, dass die Ansprache eines breiten Publikums manchmal zu einer gewissen Verwässerung einzelner Horror-Elemente führen kann. Dennoch bleibt die darstellerische Leistung bestehen und die Produktion überzeugt durch ihre solide Routine und den unverwechselbaren (Europa-)Stil der damaligen Zeit.
|
REZENSION NEON GRUSEL 09
Im Bann der Monsterspinne     
  Der neunte Teil der Gruselserie spielt in einer Welt, in der das Übersinnliche mit modernen Einflüssen verschmilzt. Mit einem gelungenen Spiel aus Atmosphäre und Spannung schafft es das Hörspiel, altbewährte Horrorelemente neu zu interpretieren. Die dichte Klanglandschaft und der gezielte Einsatz von Soundeffekten intensivieren das mystische Erlebnis, das zugleich nostalgisch und zeitgemäß wirkt.
Der neunte Teil der Gruselserie spielt in einer Welt, in der das Übersinnliche mit modernen Einflüssen verschmilzt. Mit einem gelungenen Spiel aus Atmosphäre und Spannung schafft es das Hörspiel, altbewährte Horrorelemente neu zu interpretieren. Die dichte Klanglandschaft und der gezielte Einsatz von Soundeffekten intensivieren das mystische Erlebnis, das zugleich nostalgisch und zeitgemäß wirkt.
Die narrative Struktur überzeugt durch einen klaren Spannungsbogen, der das Publikum von Beginn an fesselt. Subtile humoristische Elemente lockern die düstere Stimmung auf, ohne den ernsten Unterton der Geschichte zu verwässern. Kritiker heben hervor, dass die moderne Adaption klassischer Gruselelemente einen erfrischenden Blick auf das Genre eröffnet und dabei inhaltlich sowie formal überzeugt.
Popkulturelle Bezüge und visuelle Anspielungen verleihen dem Hörspiel zusätzliche Tiefe. Symbole, die an bekannte Werke aus Film und Literatur erinnern, werden in einem neuen Licht präsentiert. Diese Synthese aus Tradition und Innovation macht "Im Bann der Monsterspinne" zu einem annehmbaren Hörerlebnis, das sowohl eingefleischte Fans des Genres als auch Neulinge anspricht.
Zusammenfassend zeigt die neunte Folge der Neon-Grusel-Serie, wie klassische Horrortradition mit modernen Elementen zu einem (damals 1981) neuen Produkt verschmilzt. Dem Stück kann man seine atmosphärische Dichte nicht absprehen, dennoch gehört es wegen durchschnittlichen Sprecherleistungen und unterrepräsentierter Ironie bzw. Humor zu den deutlich schwächeren der Serie.
Hörenswert zum Schluss der hämisch-prollige Horst Stark als obrigkeitskritischer Polizist, der letztendlich recht in seiner Einschätzung der drohenden Gefahr behielt. Renate Pichler gab als Spinne vermutlich ihr Bestes, konnte jedoch im Gegensatz zu vielen anderen von ihr in diversen Hörspielen gesprochenen Rollen nicht ausreichend überzeugen.
|
REZENSION NEON GRUSEL 10
Draculas Insel, Kerker des Grauens     
  Das Hörspiel 'Draculas Insel, Kerker des Grauens' aus der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis gehört zu den umstrittensten, aber auch beliebtesten Episoden der Reihe. Erstmals 1981 veröffentlicht, vereint diese Folge klassische Horrorelemente mit einer Prise Trash und überbordender Fantasie. Sie steht exemplarisch für das Genre der Hörspiel-Gruselgeschichten der 1980er-Jahre, die mit dichten Soundkulissen, markanten Stimmen und dramatischen Wendungen die Zuhörer fesselten.
Das Hörspiel 'Draculas Insel, Kerker des Grauens' aus der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis gehört zu den umstrittensten, aber auch beliebtesten Episoden der Reihe. Erstmals 1981 veröffentlicht, vereint diese Folge klassische Horrorelemente mit einer Prise Trash und überbordender Fantasie. Sie steht exemplarisch für das Genre der Hörspiel-Gruselgeschichten der 1980er-Jahre, die mit dichten Soundkulissen, markanten Stimmen und dramatischen Wendungen die Zuhörer fesselten.
Die Geschichte beginnt mit einem Schiffsunglück, das eine Gruppe von Menschen auf eine mysteriöse Insel verschlägt. Schnell zeigt sich, dass es sich nicht um irgendeine Insel handelt, sondern um das Reich von Graf Dracula, der sich mit einer ganzen Armee von Vampiren verschanzt hat. Der Professor, seine Tochter und ihre Gefährten stehen einer Übermacht an Untoten gegenüber. Besonders skurril: Dracula setzt einen künstlichen Menschen ein, um Opfer auf die Insel zu locken – eine Idee, die zwar an den Haaren herbeigezogen wirkt, aber dem Hörspiel seine einzigartige Note verleiht.
Viele Fans lieben die Folge gerade wegen ihrer Absurditäten. Die Dialoge schwanken zwischen ironischem Witz und klischeehaften Horrorfloskeln. Die Szene, in der zwei Protagonisten durch das Kreuzen ihrer Arme ein Kruzifix imitieren, um Dracula und seine Diener in die Flucht zu schlagen, ist ein Paradebeispiel für den naiven Charme der Serie. Auch das Ende bleibt bewusst ambivalent – wurde Elenor wirklich gerettet oder ist sie längst zum Vampir geworden?
Die Sprecherbesetzung ist hochkarätig: Charles Regnier als Dracula, Friedrich Schütter als Professor Dark und Heidi Schaffrath als Elenor Dark verleihen dem Hörspiel trotz seiner teils absurden Handlung eine dichte Atmosphäre. Die Inszenierung von Heikedine Körting ist gewohnt professionell, und die Musikuntermalung verstärkt das klassische Grusel-Feeling.
Trotz (oder gerade wegen) zahlreicher Ungereimtheiten hat Draculas Insel, Kerker des Grauens bis heute Kultstatus. Es ist eine Folge, die weniger mit Logik als mit Stimmung überzeugt. Für Liebhaber des klassischen Horrorhörspiels bleibt sie ein absolutes Muss – irgendwo zwischen schauriger Faszination und nostalgischem Trash-Vergnügen.
|
REZENSION NEON GRUSEL 11
Der Pakt mit dem Teufel     
  Das Hörspiel 'Der Pakt mit dem Teufel' aus der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis, veröffentlicht im Jahr 1981, gehört zu den atmosphärisch dichtesten Folgen der Reihe. Anders als klassische Monster wie Dracula oder Frankenstein steht hier eine übernatürliche Bedrohung im Mittelpunkt: der Teufel selbst. Die Geschichte verbindet europäische Sagenmotive mit klassischem Horror und spielt in einer verschneiten, düsteren Szenerie, die bis heute für viele Fans den besonderen Reiz der Folge ausmacht.
Das Hörspiel 'Der Pakt mit dem Teufel' aus der Neon-Grusel-Serie von H.G. Francis, veröffentlicht im Jahr 1981, gehört zu den atmosphärisch dichtesten Folgen der Reihe. Anders als klassische Monster wie Dracula oder Frankenstein steht hier eine übernatürliche Bedrohung im Mittelpunkt: der Teufel selbst. Die Geschichte verbindet europäische Sagenmotive mit klassischem Horror und spielt in einer verschneiten, düsteren Szenerie, die bis heute für viele Fans den besonderen Reiz der Folge ausmacht.
Die Handlung beginnt mit einer Busreise, die durch ein Schneetreiben unterbrochen wird. Die Fahrgäste suchen in einem abgelegenen Schloss Schutz, das sich bald als verfluchter Ort entpuppt. Der einstige Schlossherr, der berüchtigte Schergen-Toni, hat einen dunklen Handel mit dem Teufel abgeschlossen. Um seine eigene Seele zu retten, muss er drei andere Seelen opfern. Die Anwesenden geraten in einen Strudel unheimlicher Ereignisse, während die Bedrohung immer greifbarer wird.
Besonders hervorzuheben ist die gelungene Atmosphäre. Die Vorstellung einer verschneiten, einsamen Landschaft, die in die Finsternis eines Spukschlosses übergeht, sorgt für eine fast märchenhafte, gleichzeitig aber bedrohliche Stimmung. Die Geräuschkulisse aus Windheulen, knarrenden Türen und hallenden Stimmen verstärkt das Gefühl des Unheils. Dabei bleibt der Teufel selbst die meiste Zeit unsichtbar und manifestiert sich vor allem durch die Qualen der Verdammten – ein dramaturgischer Kniff, der das Unheimliche noch verstärkt.
Die Sprecherleistungen sind umstritten. Während einige Rollen überzeugend gespielt werden, gibt es besonders bei den weiblichen Charakteren Kritik, da die überzeichnete Hysterie als störend empfunden wird. Dennoch hinterlassen einige Szenen bleibenden Eindruck, etwa wenn unsichtbare Fußabdrücke im Blut auftauchen oder wenn sich der verfluchte Schergen-Toni in seinem verzweifelten Kampf um Seelen offenbart.
Die Auflösung der Geschichte setzt auf eine bekannte Horror-Konvention: Die Bedrohung wird durch den Rückgriff auf christliche Symbolik gebannt. Wie bereits in anderen Folgen der Neon-Grusel-Serie kommt das Kreuz als letzte Rettung zum Einsatz. Allerdings bleibt das Ende ambivalent: Der Busfahrer, der die Überlebenden abholt, wird von manchen als mögliche Manifestation des Teufels selbst interpretiert. Ein beunruhigender Gedanke, der das Hörspiel über seinen eigentlichen Schluss hinaus nachwirken lässt – eine winterliche Gruselgeschichte mit infernalischer Note.
|
REZENSION NEON GRUSEL 12
Die Nacht der Todes-Ratte     
  H.G. Francis war eine Schüsselfigur der deutschen Hörspielkultur der 1980er Jahre. Mit seiner Arbeit für die "Neon-Grusel-Serie" prägte er eine ganze Generation von Hörspielbegeisterten. "Die Nacht der Todes-Ratte" erschien 1981 als zwölfte Folge der Serie und hat einen recht beklemmenden Handlungsverlauf.
H.G. Francis war eine Schüsselfigur der deutschen Hörspielkultur der 1980er Jahre. Mit seiner Arbeit für die "Neon-Grusel-Serie" prägte er eine ganze Generation von Hörspielbegeisterten. "Die Nacht der Todes-Ratte" erschien 1981 als zwölfte Folge der Serie und hat einen recht beklemmenden Handlungsverlauf.
Die Geschichte spielt in einer Kleinstadt, in der unheimliche Tierexperimente stattfinden. Eine todbringende Ratte sorgt für Angst und Schrecken, während die Protagonisten versuchen, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Der Horror entfaltet sich langsam, indem zunächst einzelne Hinweise auf das Grauen auftauchen, bevor sich das Unheil schließlich in voller Wucht zeigt.
Akustisch setzt das Hörspiel auf klassische Mittel des Schreckens. Unheilvolle Musik, krachende Effekte und eindringliche Stimmen verstärken die Bedrohlichkeit der Geschichte. Die Sprecher liefern überzeugende Darstellungen ab, die das Bedrohliche der Handlung betonen. Besonders die Todes-Ratte selbst, deren Präsenz über weite Strecken ungewiss bleibt, trägt zur unheimlichen Stimmung bei.
Popkulturell betrachtet fügt sich "Die Nacht der Todes-Ratte" in eine Ära ein, in der Hörspiele eine zentrale Rolle im Jugend- und Horrorgenre spielten. Die 1980er Jahre waren eine Blütezeit des Mediums, das als Alternative zum Fernsehen galt. Besonders die Verknüpfung von Gruselelementen mit einem spannenden Ermittlungshandlungsstrang erinnert an klassische Horrorfilme und Schauerliteratur. Auch Parallelen zu urbanen Legenden sind erkennbar, da das Motiv der mutierten, tödlichen Ratte eine häufige Angstvorstellung in urbanen Mythen ist.
Leider fehlen die für Francis typischen Zutaten Humor und Ironie in dieser Folge vollständig und nicht einmal die damals erst 32jährige, begnadete Sprecherin Donata Höffer vermag das ziemlich belanglose Hörspiel zu retten.
|
REZENSION NEON GRUSEL 13
Dem Monster auf der blutigen Spur     
  Die 1981 veröffentlichte Hörspielfolge „Dem Monster auf der blutigen Spur“ aus der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis nimmt eine Sonderstellung innerhalb der Reihe ein. Während andere Episoden meist klassische Horrormotive bedienen, orientiert sich diese Folge stärker an melodramatischen Vorbildern wie „Die Schöne und das Biest“ oder „Der Glöckner von Notre-Dame“. Besonders auffällig ist, dass erstmals ein Kind als zentrale Identifikationsfigur fungiert, was einige Hörer als Abweichung vom üblichen Gruselton empfanden.
Die 1981 veröffentlichte Hörspielfolge „Dem Monster auf der blutigen Spur“ aus der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis nimmt eine Sonderstellung innerhalb der Reihe ein. Während andere Episoden meist klassische Horrormotive bedienen, orientiert sich diese Folge stärker an melodramatischen Vorbildern wie „Die Schöne und das Biest“ oder „Der Glöckner von Notre-Dame“. Besonders auffällig ist, dass erstmals ein Kind als zentrale Identifikationsfigur fungiert, was einige Hörer als Abweichung vom üblichen Gruselton empfanden.
Die Handlung dreht sich um Salaün, eine missgestaltete Kreatur, die von Menschen gefürchtet und gefangen gehalten wird. Ein Junge befreit ihn, woraufhin sich eine ambivalente Geschichte zwischen Freundschaft und Bedrohung entfaltet. Die Erzählung ist weniger ein Horrorstück als vielmehr ein modernes Märchen mit tragischem Unterton. Gerade das Fehlen eines „bösen“ Monsters wurde von vielen Rezipienten kritisiert. Manche empfanden die Geschichte als spannendes Drama, während andere sie als langweilig oder unpassend für die Gruselserie bezeichneten.
Insbesondere das Ende sorgt für Diskussionen: Salaün wird trotz seines harmlosen Wesens als Bedrohung dargestellt und schließlich vernichtet. Dies wurde von einigen Hörern als unlogisch oder gar moralisch fragwürdig angesehen. Ein Kritiker bemerkt, dass das Hörspiel ursprünglich die Botschaft vermittelt, dass das „Monster“ in Wirklichkeit menschlich ist – doch am Ende wird es dennoch als Bedrohung behandelt und getötet. Andere loben die emotionale Tiefe der Geschichte und sehen darin eine Allegorie auf gesellschaftliche Ausgrenzung.
Technisch wurde die Produktion unterschiedlich bewertet. Während einige Sprecherleistungen, insbesondere von Sascha Draeger, positiv hervorgehoben wurden, kritisierte man die Tonmischung und die Dialogführung als inkonsistent. Ein Hörer bemerkte, dass manche Figuren scheinbar nie gemeinsam im Studio standen, da Dialoge künstlich zusammengeschnitten wirken. Auch die musikalische Untermalung wurde zwiespältig aufgenommen – während sie in früheren Veröffentlichungen atmosphärisch dichter wirkte, empfanden manche die Neuabmischung als weniger gelungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Dem Monster auf der blutigen Spur“ eine polarisierende Folge der „Neon-Grusel-Serie“ darstellt. Sie weicht von klassischen Horrorkonventionen ab und setzt stattdessen auf ein nachdenklicheres, fast sozialkritisches Märchenmotiv. Während einige Hörer diesen Ansatz als mutig und gelungen ansehen, empfinden andere ihn als fehlplatziert innerhalb einer Reihe, die normalerweise für düsteren Grusel steht. Gerade diese Kontroversen machen die Episode jedoch bis heute zu einer der meistdiskutierten der Serie.
|
REZENSION NEON GRUSEL 14
Die tödliche Begegnung mit dem Werwolf     
  Die 1981 erschienene Hörspielfolge „Die tödliche Begegnung mit dem Werwolf“ ist die vierzehnte Episode der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis. Diese Folge hebt sich durch ihren ungewöhnlichen Erzählstil von anderen Werwolf-Geschichten ab: Nicht ein klassischer Erzähler, sondern die Hauptfigur selbst berichtet über die Ereignisse – eine Erzählweise, die erst am Ende ihre volle Bedeutung entfaltet.
Die 1981 erschienene Hörspielfolge „Die tödliche Begegnung mit dem Werwolf“ ist die vierzehnte Episode der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis. Diese Folge hebt sich durch ihren ungewöhnlichen Erzählstil von anderen Werwolf-Geschichten ab: Nicht ein klassischer Erzähler, sondern die Hauptfigur selbst berichtet über die Ereignisse – eine Erzählweise, die erst am Ende ihre volle Bedeutung entfaltet.
Die Geschichte beginnt mit einer mysteriösen Mordserie während der Vollmondnächte. Zwei ältere Damen, Mutter Hethy und Tante Martha, reisen zu Besuch an und geraten in eine unheimliche Spirale aus Verdächtigungen und Entdeckungen. Die Handlung dreht sich um Vera und ihren Ehemann Henry, der sich zunehmend merkwürdig verhält und sich für einen Werwolf hält. Doch die Auflösung birgt eine unerwartete Wendung, die das gesamte Hörspiel in einem neuen Licht erscheinen lässt.
„Die tödliche Begegnung mit dem Werwolf“ wird von vielen Hörern als eine der besten Folgen der Reihe angesehen. Besonders das überraschende Ende wird oft gelobt. Doch nicht alle sind begeistert: Einige empfinden die Geschichte als langatmig und kritisieren die humorvollen Dialoge der beiden alten Damen, die zwar für viele einen besonderen Charme ausmachen, aber für andere die gruselige Atmosphäre abschwächen. Zudem wird bemängelt, dass einige Handlungslogiken nicht ganz schlüssig sind – etwa Veras widersprüchliches Verhalten oder der unklare Verwandlungsmechanismus des Werwolfs.
Hinsichtlich der Sprecherleistungen gibt es viel Lob. Katharina Brauren und Gisela Trowe als schrullige alte Damen bringen eine ungewöhnliche Dynamik in das Hörspiel, während Wolfgang Draeger als Henry eine ambivalente, zerrissene Figur verkörpert. Die musikalische Untermalung trägt ebenfalls zur dichten Atmosphäre bei, wobei einige Hörer die späteren Neuabmischungen als weniger gelungen empfinden als die Originalvertonung.
Eine Besonderheit der Episode ist der subtile schwarze Humor, der sich durch das gesamte Hörspiel zieht. Wiederkehrende Motive, wie ein ständig umkippender Eimer oder ironische Kommentare, werden von manchen als störend empfunden, während andere sie als cleveres Stilmittel interpretieren. Diese Mischung aus Horror, Drama und Komik macht die Folge einzigartig innerhalb der „Neon-Grusel-Serie“.
Insgesamt bleibt „Die tödliche Begegnung mit dem Werwolf“ eine polarisierende Episode: Für einige ein absolutes Highlight mit starker Dramaturgie und originellem Erzählelement, für andere eine zu humorlastige und weniger furchteinflößende Werwolf-Geschichte. Gerade dieser kontroverse Status trägt jedoch dazu bei, dass die Folge bis heute immer wieder diskutiert wird.
|
REZENSION NEON GRUSEL 15
Nessie – Das Ungeheuer von Loch Ness     
  „Nessie – Das Ungeheuer von Loch Ness“, die fünfzehnte Folge der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis, ist ein Hörspiel, das 1977 erstmals erschien und später in die berühmte Reihe aufgenommen wurde. Es markiert das erste Abenteuer des Reporter-Duos Tom Fawley und Eireen Fox, das die Legende des schottischen Seeungeheuers untersucht. Die Handlung dreht sich um einen Wissenschaftler, der das Rätsel von Loch Ness lösen will, während die beiden Journalisten auf eine Mischung aus Mystery und Humor stoßen. In der Popkultur steht „Nessie“ für eine Zeit, in der Hörspiele das „Kino im Kopf“ waren – ein Medium, das Fantasie und Spannung ohne visuelle Effekte entfachte.
„Nessie – Das Ungeheuer von Loch Ness“, die fünfzehnte Folge der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis, ist ein Hörspiel, das 1977 erstmals erschien und später in die berühmte Reihe aufgenommen wurde. Es markiert das erste Abenteuer des Reporter-Duos Tom Fawley und Eireen Fox, das die Legende des schottischen Seeungeheuers untersucht. Die Handlung dreht sich um einen Wissenschaftler, der das Rätsel von Loch Ness lösen will, während die beiden Journalisten auf eine Mischung aus Mystery und Humor stoßen. In der Popkultur steht „Nessie“ für eine Zeit, in der Hörspiele das „Kino im Kopf“ waren – ein Medium, das Fantasie und Spannung ohne visuelle Effekte entfachte.
Die Stärke des Hörspiels liegt in den Dialogen zwischen Tom und Eireen, die oft als witzig und spritzig gelobt werden. Die Sprecher Horst Frank und Brigitte Kollecker verleihen den Figuren Charaktertiefe und Charme, was das Zusammenspiel zu einem Highlight macht. Viele Hörer schätzen die lockere Dynamik, die an klassische Screwball-Komödien erinnert – ein Hauch von Hollywood in den schottischen Highlands. Doch nicht alle sind überzeugt: Manche bemängeln, dass die Geschichte zu wenig Grusel bietet, um in die „Neon-Grusel-Serie“ zu passen. Stattdessen wird die subtile Spannung hervorgehoben, die durch Atmosphäre und Sounddesign entsteht.
Interessant ist die Diskussion, warum „Nessie“ nicht ursprünglich Teil der Serie war. Einige vermuten, dass der Fokus auf Abenteuer statt Horror sowie die chronologische Rolle als erstes Fawley-Fox-Abenteuer eine Rolle spielten. Die Originalversion von 1977 wird oft der „Rückkehr der Klassiker“-Fassung vorgezogen, da sie eine dichtere, ungeschliffene Stimmung habe. Dies spiegelt einen Trend in der Popkultur wider: Nostalgie für unverfälschte Werke der Vergangenheit, die ohne moderne Überproduktion auskamen.
Trotz der Kritik bleibt „Nessie“ ein Klassiker. Es fängt den Zeitgeist der späten 1970er ein, als Mythen wie Loch Ness die Fantasie beflügelten und Hörspiele eine Brücke zwischen Krimi, Horror und Humor schlugen. Die Geschichte lebt von ihrer Einfachheit und den starken Stimmen, die sie auch Jahrzehnte später hörenswert machen. In der „Neon-Grusel-Serie“ mag „Nessie“ ein Außenseiter sein, doch genau das macht seinen Kultstatus aus – ein Hörspiel, das Unterhaltung über Schrecken stellt.
|
REZENSION NEON GRUSEL 16
Ungeheuer aus der Tiefe     
  Die Folge „Ungeheuer aus der Tiefe“ ist die sechzehnte Episode der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis. Sie greift ein klassisches Motiv der Science-Fiction-Horrorfilme der 1950er Jahre auf: die Mutation eines Wesens durch radioaktive Strahlung. Allerdings verleiht Francis der Geschichte eine ökologische Botschaft, die sich kritisch mit der Versenkung von Atommüll in den Ozeanen auseinandersetzt.
Die Folge „Ungeheuer aus der Tiefe“ ist die sechzehnte Episode der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis. Sie greift ein klassisches Motiv der Science-Fiction-Horrorfilme der 1950er Jahre auf: die Mutation eines Wesens durch radioaktive Strahlung. Allerdings verleiht Francis der Geschichte eine ökologische Botschaft, die sich kritisch mit der Versenkung von Atommüll in den Ozeanen auseinandersetzt.
Die Handlung spielt auf einer abgelegenen Insel, die von einer Gruppe junger Urlauber besucht wird. Dort werden sie mit einem mutierten Meereswesen konfrontiert, das nicht nur riesig ist, sondern auch über telepathische und telekinetische Fähigkeiten verfügt. Besonders unheimlich ist die Fähigkeit des Monsters, durch andere Personen zu sprechen, was eine unheilvolle Atmosphäre erzeugt. Die Geschichte eskaliert, als das Wesen beginnt, die Gruppe anzugreifen, bis es schließlich durch einen einfachen Eimer Pflanzenschutzmittel getötet wird – ein Aspekt, der von vielen Hörern als absurd empfunden wurde.
Die Folge wurde von den Hörern sehr unterschiedlich aufgenommen. Während einige die dichte Insel-Atmosphäre und die unterschwellige Gesellschaftskritik lobten, empfanden andere die Geschichte als klischeehaft und wenig spannend. Kritisiert wurde insbesondere, dass das Monster zu viele übernatürliche Fähigkeiten besitzt, was es eher lächerlich als furchteinflößend wirken lässt. Zudem sei die Handlung vorhersehbar, und viele Dialoge würden das Geschehen unnötig in die Länge ziehen.
Positiv hervorgehoben wurde jedoch die Musik, die als eine der stimmungsvollsten der gesamten Serie gilt. Die ursprüngliche Vertonung von Carsten Bohn wurde besonders geschätzt, und spätere Neuveröffentlichungen ohne seine Musik wurden von einigen Hörern als weniger atmosphärisch empfunden. Auch die Sprecher wurden weitgehend gelobt – insbesondere Andreas von der Meden und Gernot Endemann überzeugten in ihren Rollen.
Einige Rezipienten sahen in der Geschichte eine interessante Mischung aus Horror, Öko-Thriller und Abenteuer, während andere sie als zu belehrend oder unfreiwillig komisch empfanden. Besonders das offene Ende sorgt für Gesprächsstoff: Ist das Ungeheuer wirklich besiegt, oder gibt es noch weitere mutierte Kreaturen in den Tiefen des Ozeans? Diese Frage bleibt unbeantwortet und verleiht der Folge eine gewisse Nachwirkung.
|
REZENSION NEON GRUSEL 17
Die Insel der Zombies     
  Die Folge „Die Insel der Zombies“ ist die siebzehnte Episode der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis. Sie greift das klassische Motiv des Voodoo-Kultes auf und verknüpft es mit der in den 1970er und 1980er Jahren populären Zombie-Thematik. Besonders bemerkenswert ist, dass sich das Hörspiel nicht nur an klassischen Voodoo-Filmen der 1940er Jahre orientiert, sondern auch Elemente des modernen Zombiefilms aufgreift, in dem Untote durch Bisse neue Opfer infizieren.
Die Folge „Die Insel der Zombies“ ist die siebzehnte Episode der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis. Sie greift das klassische Motiv des Voodoo-Kultes auf und verknüpft es mit der in den 1970er und 1980er Jahren populären Zombie-Thematik. Besonders bemerkenswert ist, dass sich das Hörspiel nicht nur an klassischen Voodoo-Filmen der 1940er Jahre orientiert, sondern auch Elemente des modernen Zombiefilms aufgreift, in dem Untote durch Bisse neue Opfer infizieren.
Die Handlung folgt Clarissa Deighton, die die Plantage ihres verstorbenen Vaters auf einer abgelegenen karibischen Insel erbt. Doch dort herrscht eine düstere Atmosphäre: Die Einheimischen flüstern von dunklen Mächten, und bald zeigt sich, dass Tote nicht in ihren Gräbern bleiben. Gemeinsam mit Jonas Pray muss Clarissa den dunklen Geheimnissen der Insel auf den Grund gehen und sich gegen die untoten Schrecken zur Wehr setzen.
Die Folge wurde von vielen Hörern für ihre dichte Atmosphäre gelobt. Besonders die tropische Kulisse, unheimliche Trommelklänge und das allmähliche Aufdecken der düsteren Machenschaften sorgen für ein durchgehend spannendes Hörerlebnis. Die Besetzung mit Judy Winter und Uwe Friedrichsen wurde als hochkarätig wahrgenommen und ihre Darbietungen als herausragend bewertet.
Einige Hörer kritisierten jedoch, dass die Zombies eine eher passive Rolle spielen und weniger bedrohlich wirken als in vergleichbaren Filmen oder Hörspielen. Zudem wird das Ende, in dem die Zombies endgültig besiegt werden, von manchen als zu abrupt empfunden. Ein weiterer Kritikpunkt ist die teils klischeehafte Darstellung des Voodoo-Kults, der mit Satanismus gleichgesetzt wird – eine fragwürdige Vermischung, die in dieser Zeit allerdings häufig in westlichen Horrorproduktionen vorkam.
Insgesamt gilt „Die Insel der Zombies“ als eine der atmosphärisch stärksten Folgen der Serie, denn das Script ist schlüssig und sämtliche Darsteller -allen voran Judy Winter und Uwe Friedrichsen- lieferten hervorragende Arbeit ab. Die Mischung aus tropischer Exotik, schleichendem Grauen und klassischem Abenteuermotiv macht das Stück bis heute zu einer der beliebtesten Episoden der „Neon-Grusel-Serie“. Trotz kleinerer Schwächen bleibt sie ein Klassiker des deutschen Hörspielhorrors.
|
REZENSION NEON GRUSEL 18
Das Weltraum-Monster     
  Die Folge „Das Weltraum-Monster“ ist die achtzehnte und letzte Episode der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis. Sie nimmt innerhalb der Reihe eine besondere Stellung ein, da sie als einzige Folge das Science-Fiction-Genre bedient und starke Parallelen zu Ridley Scotts „Alien“ (1979) aufweist. Dies hat ihr sowohl Lob als auch Kritik eingebracht.
Die Folge „Das Weltraum-Monster“ ist die achtzehnte und letzte Episode der „Neon-Grusel-Serie“ von H.G. Francis. Sie nimmt innerhalb der Reihe eine besondere Stellung ein, da sie als einzige Folge das Science-Fiction-Genre bedient und starke Parallelen zu Ridley Scotts „Alien“ (1979) aufweist. Dies hat ihr sowohl Lob als auch Kritik eingebracht.
Die Handlung dreht sich um die Crew des Raumschiffs Drakon, das von dem Planeten Paradise zur Erde zurückkehren soll. Doch an Bord befindet sich ein fremdes Wesen, das nach und nach die Besatzung dezimiert. Die Überlebenden müssen herausfinden, wie sie das unheimliche Monster, das sich jeder Waffe widersetzt, besiegen können.
Viele Hörer schätzen die düstere und klaustrophobische Atmosphäre der Folge, die das Gefühl der Isolation im All eindrucksvoll transportiert. Besonders die unheimlichen Geräusche des Monsters und die beklemmenden Momente, in denen die Besatzung Korridor für Korridor nach dem Wesen absucht, wurden als gelungene Spannungsmomente hervorgehoben.
Kritik gibt es jedoch an der Umsetzung des Monsters selbst: Die von ihm erzeugten Geräusche wurden von einigen als unpassend empfunden, da sie eher an einen schlecht gelaunten Schlumpf als an eine furchteinflößende Kreatur erinnern. Zudem wird das Wesen nie genau beschrieben, was zwar zur Spannung beiträgt, aber auch dazu führt, dass es schwer greifbar bleibt. Der finale Trick, das Monster per Beiboot ins All zu katapultieren, wurde von manchen als zu einfach empfunden.
Die Sprecher wurden unterschiedlich bewertet. Während Horst Naumann und Judy Winter gelobt wurden, wurde die Leistung einiger anderer Sprecher als lustlos beschrieben. Besonders die Szene, in der die Überlebenden am Ende lachend ihre Rückkehr zur Erde feiern, während der Großteil der Crew verstorben ist, wurde von einigen Hörern als unpassend empfunden.
Trotz dieser Schwächen bleibt „Das Weltraum-Monster“ eine bemerkenswerte Folge der Serie. Ihre Mischung aus klassischem Survival-Horror und Science-Fiction hebt sie von den übrigen Episoden ab und macht sie zu einem interessanten Abschluss der „Neon-Grusel-Serie“.
|
Die subjektiven und irrationalen Hörspiel-Rezensionen auf dieser Seite sind
keinesfalls als Kaufempfehlungen zu verstehen.
|
| |
|